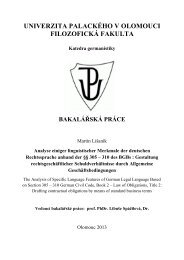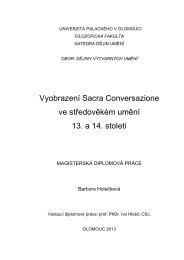3.3.1 Sieben Merkmale der Novelle - Theses
3.3.1 Sieben Merkmale der Novelle - Theses
3.3.1 Sieben Merkmale der Novelle - Theses
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zu fragen, wann er ihn wie<strong>der</strong> treffen kann, entfernt er sich ihm immer mehr: „Aber je<br />
rascher ich ging, desto unerreichbarer blieb er mir.“ 276 Der Erzähler wird immer mü<strong>der</strong>,<br />
setzt sich auf das Fass und bittet Herrn Schimon, den an<strong>der</strong>en zu sagen, dass sie auf ihn<br />
draußen warten sollen. Er bekommt keine Antwort, die Lampe erlischt und er wird von<br />
einem fremden Kellner aufgefor<strong>der</strong>t, nach Hause zu gehen. 277<br />
Die Ambiguität des ganzen Vorfalls bleibt bis zum Schluss erhalten. Nicht einmal<br />
in diesem Augenblick kann sich <strong>der</strong> Erzähler entscheiden, ob er nur geträumt hat o<strong>der</strong> ob<br />
es tatsächlich passiert ist. Die Doppeldeutigkeit wird noch durch das Goethe-Zitat aus<br />
Faust I, Walpurgisnachttraum unterstrichen: „Wolkenzug und Nebelflor/ Erhellen sich<br />
von oben;/ Luft im Laub und Wind im Rohr –/ Und alles ist zerstoben.“ 278<br />
4.2.3 Der Zentaur – eine Verherrlichung <strong>der</strong> Antike<br />
Die Antike spielt eine wichtige Rolle nicht nur im Rahmen, wie bereits dargelegt<br />
wurde, son<strong>der</strong>n auch in <strong>der</strong> Binnengeschichte. Während im Rahmen „nur“ Anspielungen<br />
auf die antike Welt und Kultur vorhanden sind, erscheint in <strong>der</strong> Binnengeschichte ein<br />
lebendiges Beispiel. Es ist nicht relevant, ob eine solche Begegnung überhaupt möglich<br />
ist, son<strong>der</strong>n was dadurch ausgesagt wird.<br />
Während seines Aufenthalts in den Alpen (höchstwahrscheinlich in Tirol)<br />
begegnet Genelli einem Zentauren, auch wenn er es zuerst nicht glauben will: „Ich<br />
glaubte im ersten Augenblicke, <strong>der</strong> Wein, den ich etwas hastig getrunken, werfe so<br />
wun<strong>der</strong>lich Blasen in meine Phantasie, daß ich am hellen Tage einen fabelhaften Traum<br />
träumte.“ 279 Als das Fabelwesen aber näher tritt, erkennt er, dass es keine Täuschung ist.<br />
Genelli, <strong>der</strong> sich selbst „ein[en] eingeteufelte[n] Heide[n]“ nennt, ist <strong>der</strong> Einzige, <strong>der</strong><br />
ruhig bleibt und „die ungemeine Schönheit des Fremdlings“ bewun<strong>der</strong>t – „de[n] ganze[n]<br />
heroische[n] Glie<strong>der</strong>bau“, den Körper, auf dem „jede Muskel spiel[t]“ und im<br />
Sonnenschein wie „Sammet schimmer[t]“ 280 .<br />
Den Zentauren bezeichnet Genelli als einen „alte[n] Heide[n]“, die meisten<br />
Dorfbewohner halten ihn „für den leibhaften Gottseibeiuns […], <strong>der</strong> gekommen sei, das<br />
sämmtliche [sic!] halbtrunkene Gesindel recht in seiner Sünden Kirchweihblüthe in die<br />
Hölle abzuführen“ 281 , wodurch <strong>der</strong> Unterschied christlich-heidnisch hervorgehoben wird.<br />
276 Ebd. S. 280.<br />
277 Vgl. ebd. S. 280 und Zitat auf S. 62, Fußnote Nr. 254.<br />
278 Ebd. S. 281.<br />
279 Ebd. S. 264.<br />
280 Ebd. S 265.<br />
281 Ebd. S. 266.<br />
66