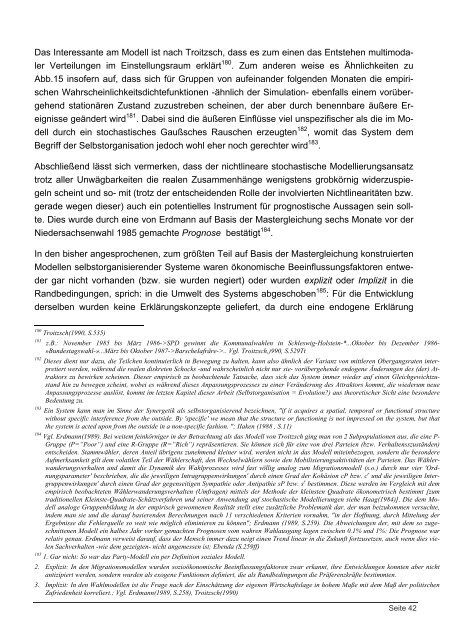Selbstorganisation M11b.pdf
Selbstorganisation M11b.pdf
Selbstorganisation M11b.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Interessante am Modell ist nach Troitzsch, dass es zum einen das Entstehen multimodaler<br />
Verteilungen im Einstellungsraum erklärt 180 . Zum anderen weise es Ähnlichkeiten zu<br />
Abb.15 insofern auf, dass sich für Gruppen von aufeinander folgenden Monaten die empirischen<br />
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen -ähnlich der Simulation- ebenfalls einem vorübergehend<br />
stationären Zustand zuzustreben scheinen, der aber durch benennbare äußere Ereignisse<br />
geändert wird 181 . Dabei sind die äußeren Einflüsse viel unspezifischer als die im Modell<br />
durch ein stochastisches Gaußsches Rauschen erzeugten 182 , womit das System dem<br />
Begriff der <strong>Selbstorganisation</strong> jedoch wohl eher noch gerechter wird 183 .<br />
Abschließend lässt sich vermerken, dass der nichtlineare stochastische Modellierungsansatz<br />
trotz aller Unwägbarkeiten die realen Zusammenhänge wenigstens grobkörnig widerzuspiegeln<br />
scheint und so- mit (trotz der entscheidenden Rolle der involvierten Nichtlinearitäten bzw.<br />
gerade wegen dieser) auch ein potentielles Instrument für prognostische Aussagen sein sollte.<br />
Dies wurde durch eine von Erdmann auf Basis der Mastergleichung sechs Monate vor der<br />
Niedersachsenwahl 1985 gemachte Prognose bestätigt 184 .<br />
In den bisher angesprochenen, zum größten Teil auf Basis der Mastergleichung konstruierten<br />
Modellen selbstorganisierender Systeme waren ökonomische Beeinflussungsfaktoren entweder<br />
gar nicht vorhanden (bzw. sie wurden negiert) oder wurden explizit oder Implizit in die<br />
Randbedingungen, sprich: in die Umwelt des Systems abgeschoben 185 : Für die Entwicklung<br />
derselben wurden keine Erklärungskonzepte geliefert, da durch eine endogene Erklärung<br />
180<br />
Troitzsch(1990, S.535)<br />
181<br />
z.B.: November 1985 bis März 1986->SPD gewinnt die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein-*...Oktober bis Dezember 1986-<br />
»Bundestagswahl-»...März bis Oktober 1987->BarscheIafräre->.. Vgl. Troitzsch,)990, S.529Tt<br />
182<br />
Dieses dient nur dazu, die Teilchen kontinuierlich in Bewegung zu halten, kann also ähnlich der Varianz von mittleren Obergangsraten interpretiert<br />
werden, während die realen diskreten Schocks -und wahrscheinlich nicht nur sie- vorübergehende endogene Änderungen des (der) Attraktors<br />
zu bewirken scheinen. Dieser empirisch zu beobachtende Tatsache, dass sich das System immer wieder auf einen Gleichgewichtzustand<br />
hin zu bewegen scheint, wobei es während dieses Anpassungsprozesses zu einer Veränderung des Attraktors kommt, die wiederum neue<br />
Anpassungsprozesse auslöst, kommt im letzten Kapitel dieser Arbeit (<strong>Selbstorganisation</strong> = Evolution?) aus theoretischer Sicht eine besondere<br />
Bedeutung zu.<br />
183<br />
Ein System kann man im Sinne der Synergetik als selbstorganisierend bezeichnen, "if it acquires a spatial, temporal or functional structure<br />
without specific interference from the outside. By 'specific' we mean that the structure or functioning is not impressed on the system, but that<br />
the system is acted upon from the outside in a non-specific fashion. "; IIaken (1988 , S.11)<br />
184<br />
Vgl. Erdmann(1989). Bei weitem feinkörniger in der Betrachtung als das Modell von Troitzsch ging man von 2 Subpopulationen aus, die eine P-<br />
Gruppe (P=“Poor“) und eine R-Gruppe (R=“Rich“) repräsentieren. Sie können sich für eine von drei Parteien (bzw. Verhaltensszuständen)<br />
entscheiden. Stammwähler, deren Anteil übrigens zunehmend kleiner wird, werden nicht in das Modell miteinbezogen, sondern die besondere<br />
Aufmerksamkeit gilt dem volatilen Teil der Wählerschaft, den Wechselwählern sowie den Mobilisierungsaktivitäten der Parteien. Das Wählerwanderungsverhalten<br />
und damit die Dynamik des Wahlprozesses wird fast völlig analog zum Migrationsmodell (s.o.) durch nur vier 'Ordnungsparameter'<br />
beschrieben, die die jeweiligen Intragruppenwirkungen' durch einen Grad der Kohäsion cP bzw. c r und die jeweiligen Intergruppenwirkungen'<br />
durch einen Grad der gegenseitigen Sympathie oder Antipathie sP bzw. s r bestimmen. Diese werden im Vergleich mit dem<br />
empirisch beobachteten Wählerwanderungsverhalten (Umfragen) mittels der Methode der kleinsten Quadrate ökonometrisch bestimmt [zum<br />
traditionellen Kleinste-Quadrate-Schätzverfahren und seiner Anwendung auf stochastische Modellierungen siehe Haag(1984)]. Die dem Modell<br />
analoge Gruppenbildung in der empirisch gewonnenen Realität stellt eine zusätzliche Problematik dar, der man beizukommen versuchte,<br />
indem man sie und die darauf basierenden Berechnungen nach 11 verschiedenen Kriterien vornahm, "in der Hoffnung, durch Mittelung der<br />
Ergebnisse die Fehlerquelle so weit wie möglich eliminieren zu können"; Erdmann (1989, S.259). Die Abweichungen der, mit dem so zugeschnittenen<br />
Modell ein halbes Jahr vorher gemachten Prognosen vom wahren Wahlausgang lagen zwischen 0.1% und 1%: Die Prognose war<br />
relativ genau. Erdmann verweist darauf, dass der Mensch immer dazu neigt einen Trend linear in die Zukunft fortzusetzen, auch wenn dies vielen<br />
Sachverhalten -wie dem gezeigten- nicht angemessen ist; Ebenda (S.259ff)<br />
185<br />
1. Gar nicht: So war das Party-Modell ein per Definition soziales Modell.<br />
2. Explizit: In den Migrationsmodellen wurden sozioökonomische Beeinflussungsfaktoren zwar erkannt, ihre Entwicklungen konnten aber nicht<br />
antizipiert werden, sondern wurden als exogene Funktionen definiert, die als Randbedingungen die Präferenzkräfte bestimmten.<br />
3. Implizit: In den Wahlmodellen ist die Frage nach der Einschätzung der eigenen Wirtschaftslage in hohem Maße mit dem Maß der politischen<br />
Zufriedenheit korreliert.; Vgl. Erdmann(1989, S.258), Troitzsch(1990)<br />
Seite 42