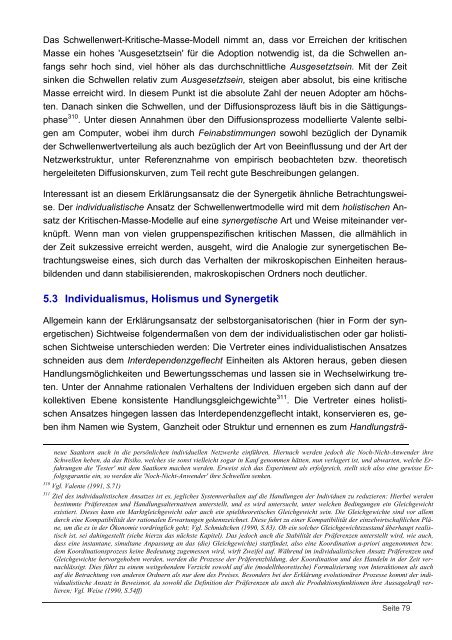Selbstorganisation M11b.pdf
Selbstorganisation M11b.pdf
Selbstorganisation M11b.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Schwellenwert-Kritische-Masse-Modell nimmt an, dass vor Erreichen der kritischen<br />
Masse ein hohes 'Ausgesetztsein' für die Adoption notwendig ist, da die Schwellen anfangs<br />
sehr hoch sind, viel höher als das durchschnittliche Ausgesetztsein. Mit der Zeit<br />
sinken die Schwellen relativ zum Ausgesetztsein, steigen aber absolut, bis eine kritische<br />
Masse erreicht wird. In diesem Punkt ist die absolute Zahl der neuen Adopter am höchsten.<br />
Danach sinken die Schwellen, und der Diffusionsprozess läuft bis in die Sättigungsphase<br />
310 . Unter diesen Annahmen über den Diffusionsprozess modellierte Valente selbigen<br />
am Computer, wobei ihm durch Feinabstimmungen sowohl bezüglich der Dynamik<br />
der Schwellenwertverteilung als auch bezüglich der Art von Beeinflussung und der Art der<br />
Netzwerkstruktur, unter Referenznahme von empirisch beobachteten bzw. theoretisch<br />
hergeleiteten Diffusionskurven, zum Teil recht gute Beschreibungen gelangen.<br />
Interessant ist an diesem Erklärungsansatz die der Synergetik ähnliche Betrachtungsweise.<br />
Der individualistische Ansatz der Schwellenwertmodelle wird mit dem holistischen Ansatz<br />
der Kritischen-Masse-Modelle auf eine synergetische Art und Weise miteinander verknüpft.<br />
Wenn man von vielen gruppenspezifischen kritischen Massen, die allmählich in<br />
der Zeit sukzessive erreicht werden, ausgeht, wird die Analogie zur synergetischen Betrachtungsweise<br />
eines, sich durch das Verhalten der mikroskopischen Einheiten herausbildenden<br />
und dann stabilisierenden, makroskopischen Ordners noch deutlicher.<br />
5.3 Individualismus, Holismus und Synergetik<br />
Allgemein kann der Erklärungsansatz der selbstorganisatorischen (hier in Form der synergetischen)<br />
Sichtweise folgendermaßen von dem der individualistischen oder gar holistischen<br />
Sichtweise unterschieden werden: Die Vertreter eines individualistischen Ansatzes<br />
schneiden aus dem Interdependenzgeflecht Einheiten als Aktoren heraus, geben diesen<br />
Handlungsmöglichkeiten und Bewertungsschemas und lassen sie in Wechselwirkung treten.<br />
Unter der Annahme rationalen Verhaltens der Individuen ergeben sich dann auf der<br />
kollektiven Ebene konsistente Handlungsgleichgewichte 311 . Die Vertreter eines holistischen<br />
Ansatzes hingegen lassen das Interdependenzgeflecht intakt, konservieren es, geben<br />
ihm Namen wie System, Ganzheit oder Struktur und ernennen es zum Handlungsträ-<br />
neue Saatkorn auch in die persönlichen individuellen Netzwerke einführen. Hiernach werden jedoch die Noch-Nicht-Anwender ihre<br />
Schwellen heben, da das Risiko, welches sie sonst vielleicht sogar in Kauf genommen hätten, nun verlagert ist, und abwarten, welche Erfahrungen<br />
die 'Tester' mit dem Saatkorn machen werden. Erweist sich das Experiment als erfolgreich, stellt sich also eine gewisse Erfolgsgarantie<br />
ein, so werden die 'Noch-Nicht-Anwender' ihre Schwellen senken.<br />
310<br />
Vgl. Valente (1991, S.71)<br />
311<br />
Ziel des individualistischen Ansatzes ist es, jegliches Systemverhalten auf die Handlungen der Individuen zu reduzieren: Hierbei werden<br />
bestimmte Präferenzen und Handlungsalternativen unterstellt, und es wird untersucht, unter welchen Bedingungen ein Gleichgewicht<br />
existiert. Dieses kann ein Marktgleichgewicht oder auch ein spieltheoretisches Gleichgewicht sein. Die Gleichgewichte sind vor allem<br />
durch eine Kompatibilität der rationalen Erwartungen gekennzeichnet. Diese fuhrt zu einer Kompatibilität der einzelwirtschaftlichen Pläne,<br />
um die es in der Ökonomie vordringlich geht; Vgl. Schmidtchen (1990, S.83). Ob ein solcher Gleichgewichtszustand überhaupt realistisch<br />
ist, sei dahingestellt (siehe hierzu das nächste Kapitel). Das jedoch auch die Stabilität der Präferenzen unterstellt wird, wie auch,<br />
dass eine instantane, simultane Anpassung an das (die) Gleichgewichte) stattfindet, also eine Koordination a-priori angenommen bzw.<br />
dem Koordinationsprozess keine Bedeutung zugemessen wird, wirft Zweifel auf. Während im individualistischen Ansatz Präferenzen und<br />
Gleichgewichte hervorgehoben werden, werden die Prozesse der Präferenzbildung, der Koordination und des Handeln in der Zeit vernachlässigt.<br />
Dies führt zu einem weitgehendem Verzicht sowohl auf die (modelltheoretische) Formalisierung von Interaktionen als auch<br />
auf die Betrachtung von anderen Ordnern als nur dem des Preises. Besonders bei der Erklärung evolutionärer Prozesse kommt der individualistische<br />
Ansatz in Beweisnot, da sowohl die Definition der Präferenzen als auch die Produktionsfunktionen ihre Aussagekraft verlieren;<br />
Vgl. Weise (1990, S.54ff)<br />
Seite 79