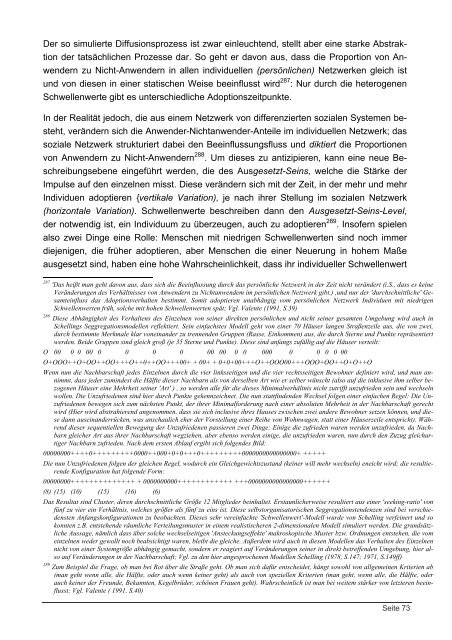Selbstorganisation M11b.pdf
Selbstorganisation M11b.pdf
Selbstorganisation M11b.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der so simulierte Diffusionsprozess ist zwar einleuchtend, stellt aber eine starke Abstraktion<br />
der tatsächlichen Prozesse dar. So geht er davon aus, dass die Proportion von Anwendern<br />
zu Nicht-Anwendern in allen individuellen (persönlichen) Netzwerken gleich ist<br />
und von diesen in einer statischen Weise beeinflusst wird 287 : Nur durch die heterogenen<br />
Schwellenwerte gibt es unterschiedliche Adoptionszeitpunkte.<br />
In der Realität jedoch, die aus einem Netzwerk von differenzierten sozialen Systemen besteht,<br />
verändern sich die Anwender-Nichtanwender-Anteile im individuellen Netzwerk; das<br />
soziale Netzwerk strukturiert dabei den Beeinflussungsfluss und diktiert die Proportionen<br />
von Anwendern zu Nicht-Anwendern 288 . Um dieses zu antizipieren, kann eine neue Beschreibungsebene<br />
eingeführt werden, die des Ausgesetzt-Seins, welche die Stärke der<br />
Impulse auf den einzelnen misst. Diese verändern sich mit der Zeit, in der mehr und mehr<br />
Individuen adoptieren {vertikale Variation), je nach ihrer Stellung im sozialen Netzwerk<br />
(horizontale Variation). Schwellenwerte beschreiben dann den Ausgesetzt-Seins-Level,<br />
der notwendig ist, ein Individuum zu überzeugen, auch zu adoptieren 289 . Insofern spielen<br />
also zwei Dinge eine Rolle: Menschen mit niedrigen Schwellenwerten sind noch immer<br />
diejenigen, die früher adoptieren, aber Menschen die einer Neuerung in hohem Maße<br />
ausgesetzt sind, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr individueller Schwellenwert<br />
287<br />
'Das heißt man geht davon aus, dass sich die Beeinflussung durch das persönliche Netzwerk in der Zeit nicht verändert (i.S., dass es keine<br />
Veränderungen des Verhältnisses von Anwendern zu Nichtanwendem im persönlichen Netzwerk gibt.) ,und nur der 'durchschnittliche' Gesamteinfluss<br />
das Adoptionsverhalten bestimmt. Somit adoptieren unabhängig vom persönlichen Netzwerk Individuen mit niedrigen<br />
Schwellenwerten früh, solche mit hohen Schwellenwerten spät; Vgl. Valente (1991, S.39)<br />
288<br />
Diese Abhängigkeit des Verhaltens des Einzelnen von seiner direkten persönlichen und nicht seiner gesamten Umgebung wird auch in<br />
Schellings Seggregationsmodellen reflektiert. Sein einfachstes Modell geht von einer 70 Häuser langen Straßenzeile aus, die von zwei,<br />
durch bestimmte Merkmale klar voneinander zu trennenden Gruppen (Rasse, Einkommen) aus, die durch Sterne und Punkte repräsentiert<br />
werden. Beide Gruppen sind gleich groß (je 35 Sterne und Punkte). Diese sind anfangs zufällig auf die Häuser verteilt:<br />
O 00 0 0 00 0 0 0 0 00 00 0 0 000 0 0 0 0 00<br />
O+OOO++O+OO++OO+++O++0++OO+++00+ + 00+ + 0+0+00+++O++OOO00+++OOO+OO++O+O++O<br />
Wenn nun die Nachbarschaft jedes Einzelnen durch die vier linksseitigen und die vier rechtsseitigen Bewohner definiert wird, und man annimmt,<br />
dass jeder zumindest die Hälfte dieser Nachbarn als von derselben Art wie er selber wünscht (also auf die inklusive ihm selber bezogenen<br />
Häuser eine Mehrheit seiner 'Art' ) , so werden alle für die dieses Minimalverhältnis nicht zutrifft unzufrieden sein und wechseln<br />
wollen. Die Unzufriedenen sind hier durch Punkte gekennzeichnet. Die nun stattfindenden Wechsel folgen einer einfachen Regel: Die Unzufriedenen<br />
bewegen sich zum nächsten Punkt, der ihrer Minimalforderung nach einer absoluten Mehrheit in der Nachbarschaft gerecht<br />
wird (Hier wird abstrahierend angenommen, dass sie sich inclusive ihres Hauses zwischen zwei andere Bewohner setzen können, und diese<br />
dann auseinanderrücken, was anschaulich eher der Vorstellung einer Reihe von Wohnwagen, statt einer Häuserzeile entspricht). Während<br />
dieser sequentiellen Bewegung der Unzufriedenen passieren zwei Dinge: Einige die zufrieden waren werden unzufrieden, da Nachbarn<br />
gleicher Art aus ihrer Nachbarschaft wegziehen, aber ebenso werden einige, die unzufrieden waren, nun durch den Zuzug gleichartiger<br />
Nachbarn zufrieden. Nach dem ersten Ablauf ergibt sich folgendes Bild:<br />
00000000++++0+++++++++0000++000+0+0+++0+++++++++0000000000000000+ +++++<br />
Die nun Unzufriedenen folgen der gleichen Regel, wodurch ein Gleichgewichtszustand (keiner will mehr wechseln) eneicht wird; die resultierende<br />
Konfiguration hat folgende Form:<br />
00000000++++++++++++++ + 0000000000++++++++++++ +++0000000000000000++++++<br />
(8) (15) (10) (15) (16) (6)<br />
Das Resultat sind Cluster, deren durchschnittliche Größe 12 Mitglieder beinhaltet. Erstaunlicherweise resultiert aus einer 'seeking-ratio' von<br />
fünf zu vier ein Verhältnis, welches größer als fünf zu eins ist. Diese selbstorganisatorischen Seggregationstendenzen sind bei verschiedensten<br />
Anfangskonfigurationen zu beobachten. Dieses sehr vereinfachte 'Schwellenwert'-Modell wurde von Schelling verfeinert und so<br />
konnten z.B. entstehende räumliche Verteilungsmuster in einem realistischeren 2-dimensionalen Modell simuliert werden. Die grundsätzliche<br />
Aussage, nämlich dass über solche wechselseitigen 'Ansteckungseffekte' makroskopische Muster bzw. Ordnungen entstehen, die vom<br />
einzelnen weder gewollt noch beabsichtigt waren, bleibt die gleiche. Außerdem wird auch in diesen Modellen das Verhalten des Einzelnen<br />
nicht von einer Systemgröße abhängig gemacht, sondern er reagiert auf Veränderungen seiner in direkt betreffenden Umgebung, hier also<br />
auf Veränderungen in der Nachbarschaft; Vgl. zu den hier angesprochenen Modellen Schelling (1978, S.147; 1971, S.149ff)<br />
289<br />
Zum Beispiel die Frage, ob man bei Rot über die Straße geht. Ob man sich dafür entscheidet, hängt sowohl von allgemeinen Kriterien ab<br />
(man geht wenn alle, die Hälfte, oder auch wenn keiner geht) als auch von speziellen Kriterien (man geht, wenn alle, die Hälfte, oder<br />
auch keiner der Freunde, Bekannten, Kegelbrüder, schönen Frauen geht). Wahrscheinlich ist man bei weitem stärker von letzteren beeinflusst;<br />
Vgl. Valente ( 1991, S.40)<br />
Seite 73