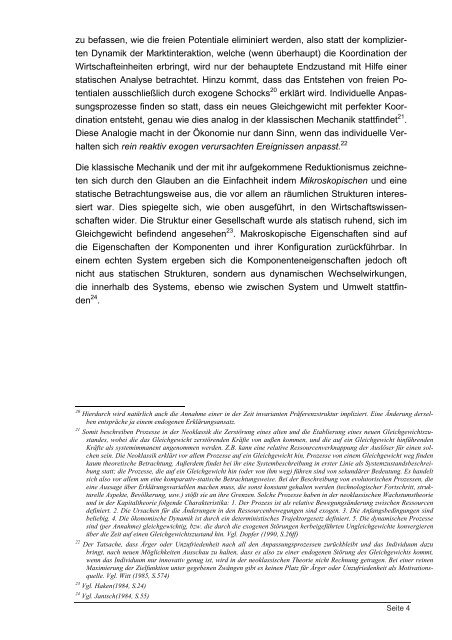Selbstorganisation M11b.pdf
Selbstorganisation M11b.pdf
Selbstorganisation M11b.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zu befassen, wie die freien Potentiale eliminiert werden, also statt der komplizierten<br />
Dynamik der Marktinteraktion, welche (wenn überhaupt) die Koordination der<br />
Wirtschafteinheiten erbringt, wird nur der behauptete Endzustand mit Hilfe einer<br />
statischen Analyse betrachtet. Hinzu kommt, dass das Entstehen von freien Potentialen<br />
ausschließlich durch exogene Schocks 20 erklärt wird. Individuelle Anpassungsprozesse<br />
finden so statt, dass ein neues Gleichgewicht mit perfekter Koordination<br />
entsteht, genau wie dies analog in der klassischen Mechanik stattfindet 21 .<br />
Diese Analogie macht in der Ökonomie nur dann Sinn, wenn das individuelle Verhalten<br />
sich rein reaktiv exogen verursachten Ereignissen anpasst. 22<br />
Die klassische Mechanik und der mit ihr aufgekommene Reduktionismus zeichneten<br />
sich durch den Glauben an die Einfachheit indem Mikroskopischen und eine<br />
statische Betrachtungsweise aus, die vor allem an räumlichen Strukturen interessiert<br />
war. Dies spiegelte sich, wie oben ausgeführt, in den Wirtschaftswissenschaften<br />
wider. Die Struktur einer Gesellschaft wurde als statisch ruhend, sich im<br />
Gleichgewicht befindend angesehen 23 . Makroskopische Eigenschaften sind auf<br />
die Eigenschaften der Komponenten und ihrer Konfiguration zurückführbar. In<br />
einem echten System ergeben sich die Komponenteneigenschaften jedoch oft<br />
nicht aus statischen Strukturen, sondern aus dynamischen Wechselwirkungen,<br />
die innerhalb des Systems, ebenso wie zwischen System und Umwelt stattfinden<br />
24 .<br />
20 Hierdurch wird natürlich auch die Annahme einer in der Zeit invarianten Präferenzstruktur impliziert. Eine Änderung derselben<br />
entspräche ja einem endogenen Erklärungsansatz.<br />
21 Somit beschreiben Prozesse in der Neoklassik die Zerstörung eines alten und die Etablierung eines neuen Gleichgewichtszustandes,<br />
wobei die das Gleichgewicht zerstörenden Kräfte von außen kommen, und die auf ein Gleichgewicht hinführenden<br />
Kräfte als systemimmanent angenommen werden. Z.B. kann eine relative Ressourcenverknappung der Auslöser für einen solchen<br />
sein. Die Neoklassik erklärt vor allem Prozesse auf ein Gleichgewicht hin, Prozesse von einem Gleichgewicht weg finden<br />
kaum theoretische Betrachtung. Außerdem findet bei ihr eine Systembeschreibung in erster Linie als Systemzustandsbeschreibung<br />
statt; die Prozesse, die auf ein Gleichgewicht hin (oder von ihm weg) führen sind von sekundärer Bedeutung. Es handelt<br />
sich also vor allem um eine komparativ-statische Betrachtungsweise. Bei der Beschreibung von evolutorischen Prozessen, die<br />
eine Aussage über Erklärungsvariablen machen muss, die sonst konstant gehalten werden (technologischer Fortschritt, strukturelle<br />
Aspekte, Bevölkerung, usw.) stößt sie an ihre Grenzen. Solche Prozesse haben in der neoklassischen Wachstumstheorie<br />
und in der Kapitaltheorie folgende Charakteristika: 1. Der Prozess ist als relative Bewegungsänderung zwischen Ressourcen<br />
definiert. 2. Die Ursachen für die Änderungen in den Ressourcenbewegungen sind exogen. 3. Die Anfangsbedingungen sind<br />
beliebig. 4. Die ökonomische Dynamik ist durch ein deterministisches Trajektorgesetz definiert. 5. Die dynamischen Prozesse<br />
sind (per Annahme) gleichgewichtig, bzw. die durch die exogenen Störungen herbeigeführten Ungleichgewichte konvergieren<br />
über die Zeit auf einen Gleichgewichtszustand hin. Vgl. Dopfer (1990, S.26ff)<br />
22 Der Tatsache, dass Ärger oder Unzufriedenheit nach all den Anpassungsprozessen zurückbleibt und das Individuum dazu<br />
bringt, nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten, dass es also zu einer endogenen Störung des Gleichgewichts kommt,<br />
wenn das Individuum nur innovativ genug ist, wird in der neoklassischen Theorie nicht Rechnung getragen. Bei einer reinen<br />
Maximierung der Zielfunktion unter gegebenen Zwängen gibt es keinen Platz für Ärger oder Unzufriedenheit als Motivationsquelle.<br />
Vgl. Witt (1985, S.574)<br />
23 Vgl. Haken(1984, S.24)<br />
24 Vgl. Jantsch(1984, S.55)<br />
Seite 4