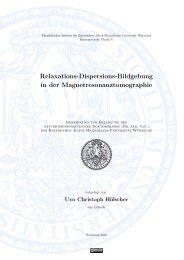Einfluss von eigener Krebserkrankung und Krankheitserfahrungen ...
Einfluss von eigener Krebserkrankung und Krankheitserfahrungen ...
Einfluss von eigener Krebserkrankung und Krankheitserfahrungen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Cappelli et al. (1999) führte eine Untersuchung mit 110 Frauen aus Hochrisikofamilien durch, um<br />
psychologische <strong>und</strong> soziale Prädiktoren für die Entscheidung zur Testung zu identifizieren. Da<strong>von</strong><br />
gaben 60% der bereits an Brustkrebs erkrankten Testpersonen an, sich testen lassen zu wollen,<br />
40% verweigerten die Analyse oder waren sich unschlüssig. Insgesamt ergab sich kein<br />
signifikanter Zusammenhang zwischen krebsspezifischer Angst <strong>und</strong> der Motivation zur<br />
genetischen Testung. Bei den Frauen aus der Brustkrebsgruppe zeigten sich aber, verglichen mit<br />
der ges<strong>und</strong>en Vergleichsgruppe, höhere Werte für die Sorge um das Erkrankungsrisiko anderer<br />
Familienmitglieder, was wiederum signifikant positiv mit der Teilnahme an der Genanalyse<br />
korreliert war. Dass der wichtigste Gr<strong>und</strong> für eine genetische Testung die Tatsache zu sein<br />
scheint, Gewissheit über das eigene Risiko, aber vor allem über das der Kinder erlangen zu<br />
wollen, bestätigen auch Lerman et al. (1995). Dies sei zum einen verb<strong>und</strong>en mit dem verstärkten<br />
Interesse nach Maßnahmen zur Prävention <strong>und</strong> Früherkennung, zum anderen mit dem daraus<br />
resultierenden Wunsch, die eigene Lebensplanung danach ausrichten zu können. Hinsichtlich<br />
psychosozialer Auswirkungen durch die Mitteilung des Testergebnisses existieren ebenso<br />
zahlreiche Studien. Lerman et al. (1996) beschrieben, dass vor der genetischen Testung sowohl<br />
bei Mutationsträgern als auch bei Nicht-Mutationsträgern vergleichbare Depressionswerte<br />
vorherrschten. Unmittelbar nach der Ergebnismitteilung stiegen die Distress-Werte an (Croyle et<br />
al. 1997). Im weiteren Zeitverlauf, 1 Monat nach der Mitteilung, stellte sich bei den Probanden,<br />
denen ein günstiges Ergebnis mitgeteilt wurde, eine signifikante Reduktion <strong>von</strong> Depressivität ein,<br />
während bei Anlageträgern eine Stagnation der psychosozialen Belastung auffällig war (Lerman<br />
et al. 1996). Frauen mit pessimistischer Lebenseinstellung oder geringem Informationsbedürfnis<br />
zeigen möglicherweise stärkere Angst als andere Probanden, wenn sie mit dem Testergebnis<br />
<strong>und</strong> weiteren follow-up-Empfehlungen konfrontiert werden (Lerman <strong>und</strong> Rimer 1995).<br />
Lynch et al. (1997) berichten, dass in ihrer Untersuchung 80% der Testpersonen, die ein<br />
negatives Ergebnis erhalten hatten, emotionale Erleichterung angaben, während über 1/3 der<br />
Probanden mit positivem Ergebnis Gefühle wie Traurigkeit, Wut <strong>und</strong> Schuld beklagten. Watson et<br />
al. (1996) fanden eine niedrige situative Angst (state anxiety) bei Frauen mit positivem<br />
Testergebnis, Patenaude et al. (1996) bei 35 Frauen mit BRCA1 oder p53 in 40% eine<br />
depressive, sowie in 25% eine affektive Symptomatik.<br />
Um die Erwartungen bezüglich der emotionalen Belastung durch die Testung zu erfassen,<br />
befragten Lerman et al. (1995) 105 Frauen aus Hochrisikofamilien.<br />
39