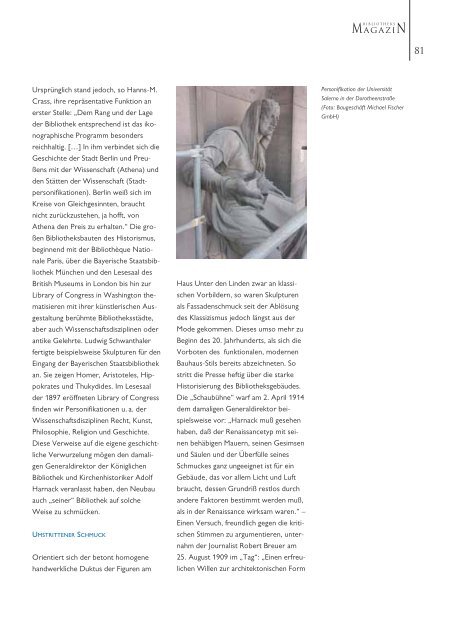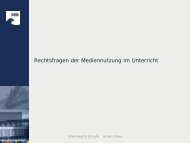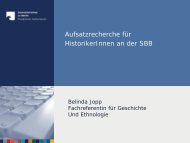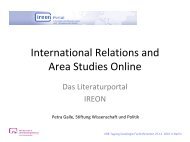bibliotheks - Staatsbibliothek zu Berlin
bibliotheks - Staatsbibliothek zu Berlin
bibliotheks - Staatsbibliothek zu Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ursprünglich stand jedoch, so Hanns-M.<br />
Crass, ihre repräsentative Funktion an<br />
erster Stelle: „Dem Rang und der Lage<br />
der Bibliothek entsprechend ist das ikonographische<br />
Programm besonders<br />
reichhaltig. […] In ihm verbindet sich die<br />
Geschichte der Stadt <strong>Berlin</strong> und Preußens<br />
mit der Wissenschaft (Athena) und<br />
den Stätten der Wissenschaft (Stadtpersonifikationen).<br />
<strong>Berlin</strong> weiß sich im<br />
Kreise von Gleichgesinnten, braucht<br />
nicht <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>stehen, ja hofft, von<br />
Athena den Preis <strong>zu</strong> erhalten.“ Die großen<br />
Bibliotheksbauten des Historismus,<br />
beginnend mit der Bibliothèque Nationale<br />
Paris, über die Bayerische <strong>Staatsbibliothek</strong><br />
München und den Lesesaal des<br />
British Museums in London bis hin <strong>zu</strong>r<br />
Library of Congress in Washington thematisieren<br />
mit ihrer künstlerischen Ausgestaltung<br />
berühmte Bibliotheksstädte,<br />
aber auch Wissenschaftsdisziplinen oder<br />
antike Gelehrte. Ludwig Schwanthaler<br />
fertigte beispielsweise Skulpturen für den<br />
Eingang der Bayerischen <strong>Staatsbibliothek</strong><br />
an. Sie zeigen Homer, Aristoteles, Hippokrates<br />
und Thukydides. Im Lesesaal<br />
der 1897 eröffneten Library of Congress<br />
finden wir Personifikationen u. a. der<br />
Wissenschaftsdisziplinen Recht, Kunst,<br />
Philosophie, Religion und Geschichte.<br />
Diese Verweise auf die eigene geschichtliche<br />
Verwurzelung mögen den damaligen<br />
Generaldirektor der Königlichen<br />
Bibliothek und Kirchenhistoriker Adolf<br />
Harnack veranlasst haben, den Neubau<br />
auch „seiner“ Bibliothek auf solche<br />
Weise <strong>zu</strong> schmücken.<br />
UMSTRITTENER SCHMUCK<br />
Orientiert sich der betont homogene<br />
handwerkliche Duktus der Figuren am<br />
Haus Unter den Linden zwar an klassischen<br />
Vorbildern, so waren Skulpturen<br />
als Fassadenschmuck seit der Ablösung<br />
des Klassizismus jedoch längst aus der<br />
Mode gekommen. Dieses umso mehr <strong>zu</strong><br />
Beginn des 20. Jahrhunderts, als sich die<br />
Vorboten des funktionalen, modernen<br />
Bauhaus-Stils bereits abzeichneten. So<br />
stritt die Presse heftig über die starke<br />
Historisierung des Bibliotheksgebäudes.<br />
Die „Schaubühne“ warf am 2. April 1914<br />
dem damaligen Generaldirektor beispielsweise<br />
vor: „Harnack muß gesehen<br />
haben, daß der Renaissancetyp mit seinen<br />
behäbigen Mauern, seinen Gesimsen<br />
und Säulen und der Überfülle seines<br />
Schmuckes ganz ungeeignet ist für ein<br />
Gebäude, das vor allem Licht und Luft<br />
braucht, dessen Grundriß restlos durch<br />
andere Faktoren bestimmt werden muß,<br />
als in der Renaissance wirksam waren.“ –<br />
Einen Versuch, freundlich gegen die kritischen<br />
Stimmen <strong>zu</strong> argumentieren, unternahm<br />
der Journalist Robert Breuer am<br />
25. August 1909 im „Tag“: „Einen erfreulichen<br />
Willen <strong>zu</strong>r architektonischen Form<br />
BIbliotheks<br />
m agazin<br />
Personifikation der Universität<br />
Salerno in der Dorotheenstraße<br />
(Foto: Baugeschäft Michael Fischer<br />
GmbH)<br />
81