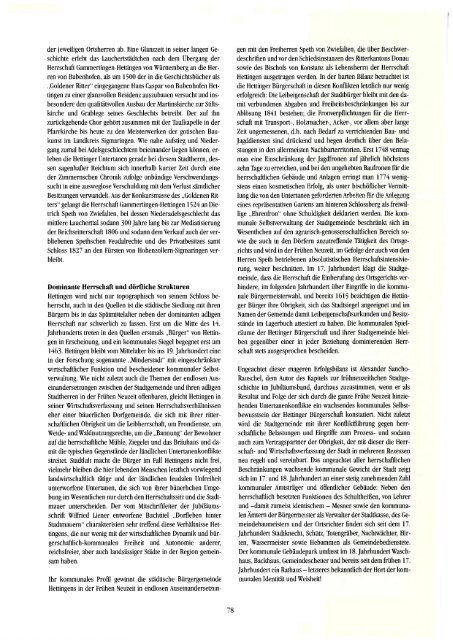Hohenzollerische Heimat - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
Hohenzollerische Heimat - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
Hohenzollerische Heimat - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der jeweiligen Ortsherren ab. Eine Glanzzeit in seiner langen Ge-<br />
schichte erlebt das Lauchertstädtchen nach dem Übergang der<br />
Herrschaft Gammertingen-Hettingen von Württemberg an die Herren<br />
von Bubenhofen, als um 1500 der in die Geschichtsbücher als<br />
„Goldener Ritter" eingegangene Hans Caspar von Bubenhofen Hettingen<br />
zu einer glanzvollen Residenz auszubauen versucht und insbesondere<br />
den qualitätsvollen Ausbau der Martinskirche zur Stiftskirche<br />
und Grablege seines Geschlechts betreibt. Der auf ihn<br />
zurückgehende Chor gehört zusammen mit der Taufkapelle in der<br />
Pfarrkirche bis heute zu den Meisterwerken der gotischen Baukunst<br />
im Landkreis Sigmaringen. Wie nahe Aufstieg und Niedergang<br />
zumal bei Adelsgeschlechtern beieinander hegen können, erleben<br />
die Hettinger Untertanen gerade bei diesem Stadtherrn, dessen<br />
sagenhafter Reichtum sich innerhalb kurzer Zeit durch eine<br />
der Zimmernschen Chronik zufolge unbändige Verschwendungssucht<br />
in eine ausweglose Verschuldung mit dem Verlust sämtlicher<br />
Besitzungen verwandelt. Aus der Konkursmasse des „Goldenen Ritters"<br />
gelangt die Herrschaft Gammertingen-Hettingen 1524 an Dietrich<br />
Speth von Zwiefalten, bei dessen Niederadelsgeschlecht das<br />
mittlere Laucherttal sodann 300 Jahre lang bis zur Mediatisierung<br />
der Reichsritterschaft 1806 und sodann dem Verkauf auch der verbliebenen<br />
Spethschen Feudalrechte und des Privatbesitzes samt<br />
Schloss 1827 an den Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen verbleibt.<br />
Dominante Herrschaft und dörfliche Strukturen<br />
Hettingen wird nicht nur topographisch von seinem Schloss beherrscht,<br />
auch in den Quellen ist die städtische Siedlung mit ihren<br />
Bürgern bis in das Spätmittelalter neben der dominanten adhgen<br />
Herrschaft nur schwerlich zu fassen. Erst um die Mitte des 14.<br />
Jahrhunderts treten in den Quellen erstmals „Bürger" von Hettingen<br />
in Erscheinung, und ein kommunales Siegel begegnet erst um<br />
1463- Hettingen bleibt vom Mittelalter bis ins 19- Jahrhundert eine<br />
in der Forschung sogenannte „Minderstadt" mit eingeschränkter<br />
wirtschaftlicher Funktion und bescheidener kommunaler Selbstverwaltung.<br />
Wie nicht zuletzt auch die Themen der endlosen Auseinandersetzungen<br />
zwischen der Stadtgemeinde und ihren adhgen<br />
Stadtherren in der Frühen Neuzeit offenbaren, gleicht Hettingen in<br />
seiner Wirtschaftsverfassung und seinen Herrschaftsverhältnissen<br />
eher einer bäuerlichen Dorfgemeinde, die sich mit ihrer ritterschaftlichen<br />
Obrigkeit um die Leibherrschaft, um Frondienste, um<br />
Weide- und Waldnutzungsrechte, um die „Bannung" der Bewohner<br />
auf die herrschaftliche Mühle, Ziegelei und das Bräuhaus und damit<br />
die typischen Gegenstände der ländlichen Untertanenkonflikte<br />
streitet. Stadtluft macht die Bürger im Fall Hettingens nicht frei,<br />
vielmehr bleiben die hier lebenden Menschen letzthch vorwiegend<br />
landwirtschaftlich tätige und der ländlichen feudalen Unfreiheit<br />
unterworfene Untertanen, die sich von ihrer bäuerhchen Umgebung<br />
im Wesentlichen nur durch den Herrschaftssitz und die Stadtmauer<br />
unterscheiden. Der vom Mitschriftleiter der Jubiläumsschrift<br />
Wilfried Liener entworfene Buchtitel „Dorfleben hinter<br />
Stadtmauern" charakterisiert sehr treffend diese Verhältnisse Hettingens,<br />
die nur wenig mit der wirtschaftlichen Dynamik und bürgerschaftlich-kommunalen<br />
Freiheit und Autonomie anderer,<br />
reichsfreier, aber auch landsässiger Städte in der Region gemeinsam<br />
haben.<br />
Ihr kommunales Profil gewinnt die städtische Bürgergemeinde<br />
Hettingens in der Frühen Neuzeit in endlosen Auseinandersetzun-<br />
78<br />
gen mit den Freiherren Speth von Zwiefalten, die über Beschwerdeschriften<br />
und vor den Schiedsinstanzen des Ritterkantons Donau<br />
sowie des Bischofs von Konstanz als Lehensherrn der Herrschaft<br />
Hettingen ausgetragen werden. In der harten Bilanz betrachtet ist<br />
die Hettinger Bürgerschaft in diesen Konflikten letzthch nur wenig<br />
erfolgreich: Die Leibeigenschaft der Stadtbürger bleibt mit den damit<br />
verbundenen Abgaben und Freiheitsbeschränkungen bis zur<br />
Ablösung 1841 bestehen; die Fronverpflichtungen für die Herrschaft<br />
mit Transport-, Holzmacher-, Acker-, vor allem aber lange<br />
Zeit ungemessenen, d.h. nach Bedarf zu verrichtenden Bau- und<br />
Jagddiensten sind drückend und hegen deuthch über den Belastungen<br />
in den allermeisten Nachbarterritorien. Erst 1748 vermag<br />
man eine Einschränkung der Jagdfronen auf jährlich höchstens<br />
zehn Tage zu erreichen, und bei den ungehebten Baufronen für die<br />
herrschaftlichen Gebäude und Anlagen erringt man 1774 wenigstens<br />
einen kosmetischen Erfolg, als unter bischöflicher Vermittlung<br />
die von den Untertanen geforderten Arbeiten für die Anlegung<br />
eines repräsentativen Gartens am hinteren Schlossberg als freiwillige<br />
„Ehrenfron" ohne Schuldigkeit deklariert werden. Die kommunale<br />
Selbstverwaltung der Stadtgemeinde beschränkt sich im<br />
Wesenthchen auf den agrarisch-genossenschaftlichen Bereich sowie<br />
die auch in den Dörfern anzutreffende Tätigkeit des Ortsgerichts<br />
und wird in der Frühen Neuzeit, im Gefolge der auch von den<br />
Herren Speth betriebenen absolutistischen Herrschaftsintensivierung,<br />
weiter beschnitten. Im 17. Jahrhundert klagt die Stadtgemeinde,<br />
dass die Herrschaft die Einberufung des Ortsgerichts verhindere,<br />
im folgenden Jahrhundert über Eingriffe in die kommunale<br />
Bürgermeisterwahl, und bereits 1615 bezichtigen die Hettinger<br />
Bürger ihre Obrigkeit, sich das Stadtsiegel angeeignet und im<br />
Namen der Gemeinde damit Leibeigenschaftsurkunden und Besitzstände<br />
im Lagerbuch attestiert zu haben. Die kommunalen Spielräume<br />
der Hettinger Bürgerschaft und ihrer Stadtgemeinde bleiben<br />
gegenüber einer in jeder Beziehung dominierenden Herrschaft<br />
stets ausgesprochen bescheiden.<br />
Ungeachtet dieser mageren Erfolgsbilanz ist Alexander Sancho-<br />
Rauschel, dem Autor des Kapitels zur frühneuzeithchen Stadtgeschichte<br />
im Jubiläumsband, durchaus zuzustimmen, wenn er als<br />
Resultat und Folge der sich durch die ganze Frühe Neuzeit hinziehenden<br />
Untertanenkonflikte ein wachsendes kommunales Selbstbewusstsein<br />
der Hettinger Bürgerschaft konstatiert. Nicht zuletzt<br />
wird die Stadtgemeinde mit ihrer Konfliktführung gegen herrschaftliche<br />
Belastungen und Eingriffe zum Prozess- und sodann<br />
auch zum Vertragspartner der Obrigkeit, der mit dieser die Herrschaft-<br />
und Wirtschaftsverfassung der Stadt in mehreren Rezessen<br />
neu regelt und vereinbart. Das ungeachtet aller herrschaftlichen<br />
Beschränkungen wachsende kommunale Gewicht der Stadt zeigt<br />
sich im 17. und 18. Jahrhundert an einer stetig zunehmenden Zahl<br />
kommunaler Amtsträger und öffentlicher Gebäude: Neben den<br />
herrschaftlich besetzten Funktionen des Schultheißen, von Lehrer<br />
und -damit zumeist identischem - Mesner sowie den kommunalen<br />
Ämtern der Bürgermeister als Verwalter der Stadtkasse, des Gemeindebaumeisters<br />
und der Ortsrichter finden sich seit dem 17.<br />
Jahrhundert Stadtknecht, Schütz, Totengräber, Nachtwächter, Hirten,<br />
Wassermeister sowie Hebammen als Gemeindebedienstete.<br />
Der kommunale Gebäudepark umfasst im 18. Jahrhundert Waschhaus,<br />
Backhaus, Gemeindescheuer und bereits seit dem frühen 17.<br />
Jahrhundert ein Rathaus - letzteres bekanntlich der Hort der kommunalen<br />
Identität und Weisheit!