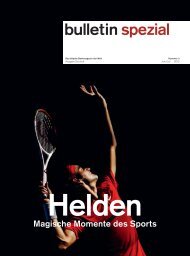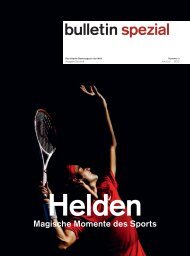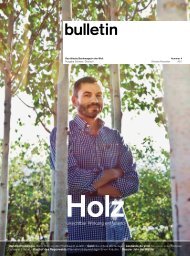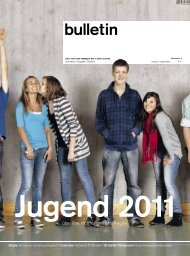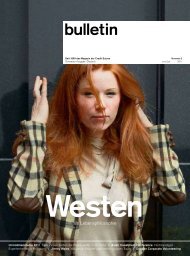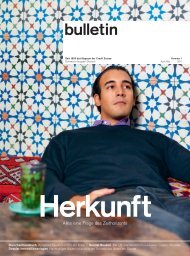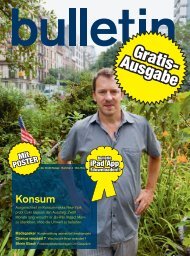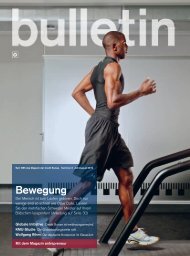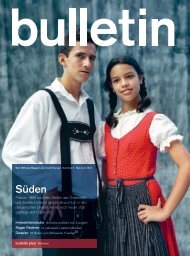bull_99_04
Credit Suisse bulletin, 1999/04
Credit Suisse bulletin, 1999/04
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ECONOMIC RESEARCH<br />
– Viertens ist Einstimmigkeit bei den Entscheiden<br />
umso schwieriger zu erreichen,<br />
je grösser die Gemeinschaft ist. Bereits<br />
mit der Realisierung des gemeinsamen<br />
Binnenmarktes hat man in vielen Bereichen<br />
zum Prinzip der qualifizierten Mehrheit<br />
gewechselt (62 von 87 Stimmen).<br />
Ob die EU den Mut hat, dies auf weitere<br />
Gebiete auszudehnen – beispielsweise die<br />
Steuerpolitik –, ist noch völlig offen.<br />
Die Kandidaten stehen Schlange<br />
Wie rasch es der EU gelingt, ihre eigenen<br />
Reformen durchzusetzen, um erweiterungsfähig<br />
zu bleiben, ist entscheidend für<br />
den Fahrplan der Osterweiterung. Derzeit<br />
Beitritt bedeutet Quantensprung<br />
Nun muss aber nicht nur die EU gerüstet<br />
sein, die Kandidaten aufzunehmen. Diese<br />
selbst haben eine Reihe von Voraussetzungen<br />
zu erfüllen. Zunächst achtet die<br />
EU auf die institutionelle Stabilität. Eine<br />
demokratische und rechtsstaatliche Ordnung,<br />
die Wahrung der Menschenrechte<br />
sowie die Achtung und der Schutz von<br />
Minderheiten sind eine Grundvoraussetzung.<br />
Ausserdem muss eine funktionsfähige<br />
Marktwirtschaft etabliert sein. Seit<br />
dem Ende der Planwirtschaft haben die<br />
Länder diesbezüglich zwar grosse Fortschritte<br />
erzielt. Doch müssen sie dereinst<br />
auch in der Lage sein, dem Wettbewerbsdruck<br />
innerhalb der EU standzuhalten.<br />
Und schliesslich haben die Beitrittskandidaten<br />
die gesamte Rechtsordnung der<br />
EU – den sogenannten «acquis communautaire»<br />
– zu übernehmen. Den Ländern<br />
kommt zugute, dass sie bei ihrem Neubeginn<br />
schon früh und in vielen Bereichen<br />
EU-REFORM: AUCH DIE SCHWEIZ IST BETROFFEN<br />
– Die Vertiefung des EU-Binnenmarktes kommt den hiesigen Unternehmen zugute. Mit den bilateralen<br />
Verträgen könnten sie künftig diesen Wirtschaftsraum vom Standort Schweiz aus besser erschliessen.<br />
– Mit der Perspektive auf einen EU-Beitritt gewinnen die Länder Mittel- und Osteuropas für Schweizer<br />
Firmen an Attraktivität. Sie sind dann nicht mehr nur als Produktionsstandort interessant, sondern auch als<br />
Eingangstor in die Europäische Union.<br />
– Wenn die EU im Rahmen der Reform ihrer Agrarpolitik die Preise weiter senkt, muss auch die Schweiz<br />
nachziehen. Nur so wird unsere Landwirtschaft in der Lage sein, die neuen Exportchancen wirklich zu<br />
nutzen (siehe auch Beitrag auf S. 34ff).<br />
– Die mit der EU ausgehandelte Personenfreizügigkeit wird dereinst auch bezüglich der neuen EU-Länder<br />
gelten. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Schweiz nach sieben Jahren nochmals über den Vertrag<br />
abstimmen kann und die volle Freizügigkeit erst nach zwölf Jahren gilt – also nicht vor 2013.<br />
– Je stärker sich die Gemeinschaft erweitert, desto schwieriger wird es für die Schweiz, mit ihr zu verhandeln<br />
– ob im Hinblick auf vertiefte bilaterale Beziehungen oder einen längerfristigen EU-Beitritt. Schon beim<br />
jetzigen bilateralen Vertragswerk hat sich gezeigt, dass die Schweiz eigentlich nicht mit der EU, sondern<br />
faktisch mit 15 Mitgliedstaaten verhandeln musste.<br />
sind in Brüssel 14 Beitrittsgesuche hängig.<br />
Den Kopf der Warteschlange bilden Estland,<br />
Polen, Slowenien, Tschechien, Ungarn<br />
und Zypern. Mit ihnen laufen seit<br />
April 1<strong>99</strong>8 konkrete Beitrittsverhandlungen.<br />
Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien<br />
und die Slowakei bilden den Mittelteil;<br />
sie können bei entsprechenden Fortschritten<br />
zur Kopfgruppe aufschliessen. Die drei<br />
Gesuche von Malta, der Schweiz und der<br />
Türkei sind auf Eis gelegt.<br />
Die Verhandlungen mit der Kopfgruppe<br />
laufen zwar weitgehend parallel. Es ist<br />
aber nicht damit zu rechnen, dass automatisch<br />
alle sechs Länder gleichzeitig<br />
Aufnahme finden. Die EU nimmt auf<br />
den unterschiedlichen Entwicklungsstand<br />
Rücksicht. Sie hat bewusst auch keine<br />
feste Terminzusage gemacht. Die Beitrittskandidaten<br />
selber haben aber ganz<br />
konkrete Vorstellungen. Besonders selbstsicher<br />
tritt Polen auf, das eine Mitgliedschaft<br />
ab 2003 anstrebt.<br />
Die Fläche der EU wächst durch eine<br />
erste Osterweiterung um 17 Prozent (siehe<br />
Tabelle S. 40). Im gleichen Ausmass<br />
nimmt die Bevölkerung zu. Hingegen<br />
steigt das Bruttoinlandprodukt lediglich<br />
um vier Prozent, weil die sechs Beitrittskandidaten<br />
im Vergleich zum EU-Durchschnitt<br />
einen deutlich tieferen Wohlstand<br />
pro Kopf aufweisen. Berücksichtigt man<br />
allerdings die Kaufkraft, dann verringern<br />
sich die Unterschiede recht markant.<br />
die Gesetzgebung der EU zum Vorbild<br />
genommen haben.<br />
Die Annäherung an die EU findet also<br />
nicht erst seit der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen<br />
statt. Brüssel hat in den<br />
Neunzigerjahren die Beziehungen zu den<br />
Ländern Mittel- und Osteuropas schrittweise<br />
vertieft. Deren Aufnahme als Mitglieder<br />
ist jedoch ein echter Quantensprung.<br />
Er will gut vorbereitet sein.<br />
FRITZ STAHEL, TELEFON 01 333 32 84<br />
FRITZ.STAHEL@CREDIT-SUISSE.CH<br />
41<br />
CREDIT SUISSE BULLETIN 4 |<strong>99</strong>