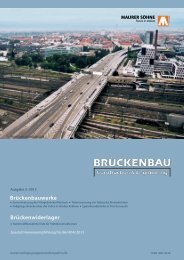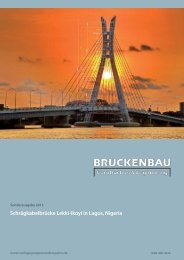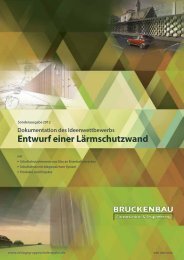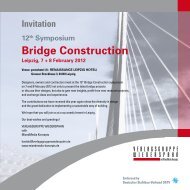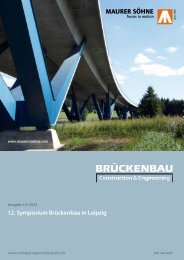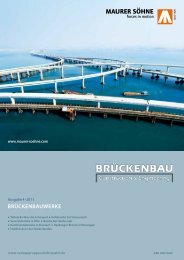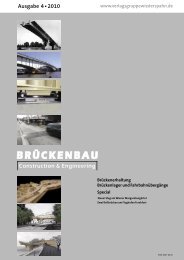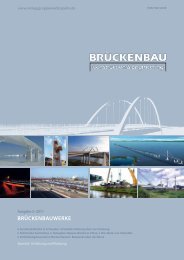11. Symposium Brückenbau in Leipzig - zeitschrift-brueckenbau ...
11. Symposium Brückenbau in Leipzig - zeitschrift-brueckenbau ...
11. Symposium Brückenbau in Leipzig - zeitschrift-brueckenbau ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3 Vor- und Nachteile<br />
der <strong>in</strong>tegralen Bauweise<br />
Integrale Bauwerke und zum Teil mit<br />
E<strong>in</strong>schränkungen auch semi<strong>in</strong>tegrale<br />
Bauwerke bieten h<strong>in</strong>sichtlich der Gestal-<br />
tung, Wirtschaftlichkeit, Nutzung und<br />
Unterhaltung Vorteile gegenüber Brü-<br />
cken mit Lagern und Dilatationsfugen.<br />
Die wesentlichen Vorteile s<strong>in</strong>d nach<br />
[5] [6]:<br />
– der Entfall von Verschleißbauteilen<br />
(Fahrbahnübergänge, Lager) und<br />
damit die Verm<strong>in</strong>derung der Instandhaltungskosten,<br />
– e<strong>in</strong> höherer Fahrkomfort und die Reduzierung<br />
der Lärmemissionen durch<br />
den Entfall der Fahrbahnübergangskonstruktionen,<br />
– die Vermeidung von direktem Taumittelzutritt<br />
wegen des Verzichts auf<br />
Fugen,<br />
– schlanke und ästhetische Bauwerke<br />
wegen ger<strong>in</strong>gerer Bauteilabmes-<br />
sungen,<br />
– e<strong>in</strong>e größere Freiheit bei der Wahl der<br />
Stützweiten (auch kle<strong>in</strong>e Randfelder<br />
ohne abhebende Kräfte s<strong>in</strong>d möglich),<br />
– der Ansatz der aussteifenden Wirkung<br />
der Widerlagerh<strong>in</strong>terfüllung, zum<br />
Beispiel für die Lastfälle W<strong>in</strong>d und<br />
Bremsen,<br />
– größere Traglastreserven im Grenzzustand<br />
der Tragfähigkeit.<br />
Dem stehen folgende Nachteile gegen-<br />
über:<br />
– Es s<strong>in</strong>d erhöhte Anforderungen an das<br />
geotechnische Entwurfsgutachten zu<br />
stellen, da obere und untere Grenzwerte<br />
der Bodenkennwerte benötigt<br />
werden.<br />
– Die Berechnung ist aufwendiger, da<br />
die Interaktion von Bauwerk und<br />
Boden zu berücksichtigen ist.<br />
– Die realistische Erfassung der bemessungsrelevanten<br />
Parameter ist schwie-<br />
riger (Boden, Steifigkeiten, E-Modul).<br />
– Es s<strong>in</strong>d planmäßig Zwangskräfte vorhanden.<br />
– Der Baugrund muss setzungsunempf<strong>in</strong>dlich,<br />
zugleich aber horizontal<br />
nachgiebig se<strong>in</strong>.<br />
– Planungs- und Baufehler s<strong>in</strong>d nur sehr<br />
schwer zu korrigieren.<br />
– Zyklische Temperaturverformungen<br />
können Setzungen <strong>in</strong> der H<strong>in</strong>terfüllung<br />
hervorrufen.<br />
1 1 . SYM P O S I U M L E I PZ I G<br />
3 Aquädukt von Segovia<br />
© Manuel Gonzáles Olaechea y Franco/www.wikipedia.de<br />
4 Historie<br />
Vom Beg<strong>in</strong>n des Massivbrückenbaus im<br />
Altertum bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
war die fugenlose Bauweise<br />
die gängige Bauweise. Wie robust und<br />
dauerhaft solche Konstruktionen s<strong>in</strong>d,<br />
zeigen Zeugnisse aus der Römerzeit,<br />
wie unter anderem das Aquädukt von<br />
Segovia mit e<strong>in</strong>er Länge von 814 m, das<br />
heute noch als Wasserleitung dient.<br />
Aber auch aus den Gründerjahren des<br />
Eisenbahnbaues um 1850 und der ersten<br />
Zeit des Autobahnbaues um 1930 existieren<br />
Zeugnisse dieser langlebigen Bau-<br />
weise, wie zum Beispiel die 1851 fertiggestellte<br />
574 m lange Göltzschtalbrücke,<br />
die als größte Ziegelste<strong>in</strong>brücke der Welt<br />
bekannt ist.<br />
Doch nicht nur im Mauerwerksbau kam<br />
die <strong>in</strong>tegrale Bauweise zum E<strong>in</strong>satz,<br />
Stahlbeton- und Spannbetonbauwerke<br />
wurden zunächst ebenfalls weitgehend<br />
lager- und fugenlos errichtet. So gibt es<br />
zahlreiche Rahmenbauwerke und sogar<br />
größere Talbrücken, die <strong>in</strong>tegral bzw.<br />
semi<strong>in</strong>tegral ausgeführt wurden. Mit<br />
dem stetigen Anwachsen der Bauwerkslängen,<br />
dem Siegeszug des Spannbetons<br />
und der starken Verbreitung des Takt-<br />
schiebeverfahrens, das e<strong>in</strong>e monolithische<br />
Verb<strong>in</strong>dung quasi ausschließt,<br />
wurde die <strong>in</strong>tegrale bzw. semi<strong>in</strong>tegrale<br />
Bauweise zurückgedrängt. Zur sicheren<br />
Beherrschung der Zwängungen aus<br />
Vorspannung, Schw<strong>in</strong>den, Kriechen,<br />
Stützensenkung und vor allem Temperatur<br />
sowie zur Vermeidung von Rissen<br />
wurden zunehmend zwängungsarme<br />
bzw. -freie Systeme durch die gezielte<br />
Anordnung von Lagern und Fahrbahnübergängen<br />
gewählt. Lager und Fugen-<br />
übergangskonstruktionen entwickelten<br />
sich zu Standardelementen im Brücken-<br />
bau und waren selbstverständlicher<br />
Bestandteil jeder Brücke. Erste gegen-<br />
läufige Tendenzen waren <strong>in</strong> den 1980er<br />
Jahren bei der Umsetzung kle<strong>in</strong>erer Rah-<br />
menbrücken erkennbar. Bei längeren<br />
Talquerungen deutete sich durch die<br />
Konzeption von Festpfeilergruppen oder<br />
e<strong>in</strong>er »schwimmenden Lagerung« e<strong>in</strong>e<br />
Tendenz zur semi<strong>in</strong>tegralen Bauweise an.<br />
5 Besonderheiten<br />
der <strong>in</strong>tegralen Bauweise<br />
Bei <strong>in</strong>tegralen Bauwerken bilden die<br />
Widerlager und der Überbau e<strong>in</strong>e mono-<br />
lithische Struktur. Demzufolge ist der<br />
Baugrund nicht nur als E<strong>in</strong>wirkung auf<br />
das Tragwerk zu berücksichtigen, son-<br />
dern ist Systembestandteil und fließt<br />
mit se<strong>in</strong>en Baustoffeigenschaften als<br />
<strong>in</strong>tegraler Bestandteil <strong>in</strong> das statische<br />
Gesamtmodell e<strong>in</strong>.<br />
Aus Temperatur und damit verbundener<br />
Längenänderung entstehen Zwangs-<br />
beanspruchungen im Bauwerk. Die Ver-<br />
schiebungen und Verdrehungen wirken<br />
aber auch auf den Baugrund, <strong>in</strong> den die<br />
Brücke e<strong>in</strong>gebettet ist. Im Jahresverlauf<br />
mit Sommer- und W<strong>in</strong>terstellung treten<br />
zudem zahlreiche Zyklen mit kle<strong>in</strong>eren<br />
Temperaturschwankungen auf. [4]<br />
Die Zwangsschnittgrößen im Bauwerk<br />
s<strong>in</strong>d im Wesentlichen abhängig von der<br />
Steifigkeit des Bauwerks, des Baugrunds<br />
und der H<strong>in</strong>terfüllung. Der Erddruck<br />
h<strong>in</strong>ter der Widerlagerwand ist wiederum<br />
abhängig von der jeweiligen Wandverformung:<br />
Er kann rechnerisch zwischen<br />
dem halben aktiven und dem mobilisierten<br />
passiven Erddruck nach Vogt [7] [8]<br />
[9] variieren.<br />
1 . 2011 | BRÜCKENBAU<br />
35