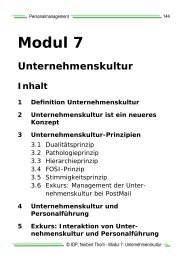1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3.3 Individuumsbezogene Voraussetzungen - 35 -<br />
3.3 Individuumsbezogene Voraussetzungen<br />
3.3.1 Engagement<br />
Neben der in Abschnitt 3.2.4 erwähnten Übernahme von zusätzlicher Verantwortung muss<br />
der einzelne Mitarbeiter auch bereit sein, seine individuellen Wirklichkeitskonstruktionen <strong>und</strong><br />
damit sein Wissen dem Unternehmen zugänglich zu machen. Nur so ist eine<br />
Weiterentwicklung über das persönliche Wissen jedes Einzelnen hinaus möglich. Es entsteht<br />
ein kollektiver Wissensvorrat, der die Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> organisationales Lernen bildet. Es wird<br />
deutlich, dass der Unterschied zwischen individuellem <strong>und</strong> organisationalem Lernen darin<br />
liegt, dass in letzterem die Bildung eines gemeinsamen Konsenses erforderlich ist, der sich<br />
auf die Bedürfnisse <strong>und</strong> Werte aller <strong>Organisation</strong>smitglieder bezieht. 123<br />
Da aber Wissen auch Macht darstellt, ist mit der Offenheit des individuellen Wissens auch ein<br />
persönlicher Machtverzicht verb<strong>und</strong>en. Dem Einzelnen ist innerhalb des Unternehmens die<br />
Möglichkeit gegeben, sich durch das Zurückhalten von wichtigen Informationen unentbehr-<br />
lich zu machen <strong>und</strong> seine Position gegenüber den Mitarbeitern zu stärken. Er kann sich auf<br />
diese Weise ein sogenanntes “Informationsmonopol” 124 aufbauen. Als Antrieb <strong>für</strong> das Indivi-<br />
duum, diesen Verlust an Macht zu akzeptieren, müssen auf der personellen Ebene Anreize in<br />
Form von finanziellen Belohnungen, Preisen <strong>und</strong> verschiedenen Arten von Anerkennung ge-<br />
boten werden. 125 Auf der kulturellen Ebene steht die Erzeugung einer diesbezüglichen Ein-<br />
stellung des Mitarbeiters im Vordergr<strong>und</strong>. Er muss das neue Umfeld des organisationalen<br />
Lernens erkennen <strong>und</strong> ausnutzen. WILMES bezeichnet dieses erforderliche Engagement tref-<br />
fend als “Wollen” 126 des Mitarbeiters. Im Gegensatz zum “Wollen” ist das “Dürfen” von der<br />
Gewährung von Freiräumen durch die Führung abhängig. 127<br />
In diesem Sinne fordert auch WIEGAND eine wesentlich offenere Orientierung an Emotionen<br />
<strong>und</strong> Emotionskonzepten als bisher. Seines Erachtens müssen die spezifischen kognitiven <strong>und</strong><br />
123 Vgl. Probst/Büchel (1994), S. 20.<br />
124 Vgl. von Krogh/Venzin (1997), S. 23.<br />
125 Vgl. Rohner (1997), S. 69.<br />
126 Vgl. Wilmes (1995), S. 146 f.<br />
127 Vgl. hierzu auch Reinhardt (1995), S. 328 <strong>und</strong> 335, wo er den Begriff des “Commitment” <strong>für</strong> den<br />
gleichen Sachverhalt verwendet.