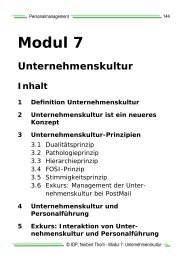1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.2 Autonomie - 55 -<br />
Die Förderung der Autonomie der Subeinheiten führt zu Red<strong>und</strong>anzen in der Struktur <strong>und</strong> zu<br />
einer verbesserten lokalen Problemlösungsfähigkeit, was wiederum die Flexibilität der Or-<br />
ganisation erhöht. 213<br />
Der Vorteil von Red<strong>und</strong>anzen in einer Struktur wird ersichtlich, wenn wir an ein komplexes<br />
System denken. Werden die Elemente dieses Systems in Serie geschaltet, entspricht die Zu-<br />
verlässigkeit des ganzen Systems der Zuverlässigkeit seines unzuverlässigsten Elements.<br />
Durch den Einbau von red<strong>und</strong>anten Strukturen in Form paralleler Anordnung von Elementen<br />
erhöht sich die Zuverlässigkeit des Systems. Sie entspricht nun der Zuverlässigkeit der zuver-<br />
lässigsten Elemente, die zusammen die Systemaufgabe erfüllen können. Auf dem gleichen<br />
Prinzip baut auch die weltweite Vernetzung von Informationssystemen im Internet auf. 214<br />
Autonomie ist ebenfalls als Gr<strong>und</strong>voraussetzung <strong>für</strong> die Realisierung von Organizational<br />
Slack anzusehen, da der Mitarbeiter nur bei Vorhandensein eines Handlungspielraums einen<br />
Teil seiner mit der Stelle verb<strong>und</strong>enen Ressourcen, beispielsweise <strong>für</strong> die Reflexion seiner<br />
Aufgabe, einsetzen kann. 215 Zusätzlich erhält er durch die gewährte Eigenverantwortung die<br />
notwendige Motivation, diese persönliche Freiheit im Sinne seiner Aufgabe einzusetzen, <strong>und</strong><br />
nicht <strong>für</strong> Trägheit <strong>und</strong> Bewahrung von Verhaltensweisen zu missbrauchen. 216<br />
So ist es verständlich, dass ORTNER Autonomie, ob sie nun individuell oder gruppal orientiert<br />
auftritt, als die treibende Kraft <strong>für</strong> organisationales Lernen bezeichnet <strong>und</strong> ihr eine überra-<br />
gende Bedeutung zumisst. 217<br />
Die Gewährung von Autonomie ist nicht als völliger Abbau von Regulierungen zu verstehen.<br />
Durch die Entkopplung wird lediglich die zentrale Steuerung <strong>und</strong> Kontrolle reduziert <strong>und</strong> mit<br />
individueller <strong>und</strong> kollektiver Selbst-Regulation ersetzt. Durch die Umsetzung des in der<br />
westlichen Gesellschaft tief verankerten Gedankens der demokratischen Einflussnahme folgt<br />
eine Verlagerung <strong>und</strong> Delegation von Aufgaben <strong>und</strong> Kompetenzen aus zentralen Bereichen in<br />
dezentrale operative Einheiten. 218<br />
Dieser Einbezug von gr<strong>und</strong>legenden Werten des Individuums (Demokratie <strong>und</strong> Freiheit) birgt<br />
das Potential einer stärkeren Verbindung von <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> Individuum. Die Ziele des or-<br />
213 Vgl. Schwaninger/Flaschka (1996), S. 17; Schwaninger (1995), S. 5; Probst (1992), S. 486 f.<br />
214 Vgl. Reinhardt (1995), S. 113.<br />
215 Vgl. Abschnitt 3.3.5, S. 9.<br />
216 Vgl. Abschnitt 3.2.6, S. 9.<br />
217 Vgl. Ortner (1995), S. 136.