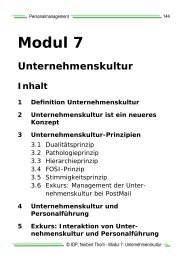1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
1. Einführung - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.4 Flexibilität - 60 -<br />
Auf der strukturellen Ebene bieten sich zwei Varianten an:<br />
<strong>1.</strong> Die angestrebten Bindungen können durch heterarchische Strukturen geschaffen werden,<br />
die mit zentralen Strukturelementen verb<strong>und</strong>en werden. 245 Es werden Entscheidungs- <strong>und</strong><br />
Steuerungshierarchien geschaffen, die den Rahmen <strong>für</strong> lokale Entscheide im Sinne des<br />
Gesamtunternehmens bilden <strong>und</strong> gleichzeitig den Entscheidungsträgern vor Ort genügend<br />
Freiraum <strong>für</strong> ihre Entscheidungen lassen. 246<br />
2. Die Kombination von stabilisierenden Strukturelementen mit solchen, die eine Erhöhung<br />
der Flexibilität bewirken, wird durch die Bildung von Zelt- bzw. temporären Strukturen<br />
realisiert, welche in Palast- bzw. permanenten Strukturen eingebettet werden. 247 Auf diese<br />
Weise kann ein lernfre<strong>und</strong>licher, temporärer Handlungsrahmen geschaffen werden, der<br />
im Sinne einer Sek<strong>und</strong>ärorganisation von einer permanenten Struktur – der Primärorgani-<br />
sation – überlagert wird. 248<br />
Die Flexibilität der Struktur besteht bei beiden Varianten durch die Balance von Loslösung<br />
<strong>und</strong> Vernetzung der Subsysteme des Unternehmens. Durch den Ausgangspunkt – die Forde-<br />
rung nach Flexibilität <strong>und</strong> nicht nach Stabilität steht im Mittelpunkt – wird deutlich, dass der<br />
Schwerpunkt auf Seiten der Loslösung der Einzelteile liegen muss. 249 Es findet eine<br />
Verschiebung der Bedeutung vom Gesamtunternehmen zu seinen Einzelteilen statt, was auch<br />
dem Gedanken der Autonomie 250 entspricht.<br />
245 Vgl. Abschnitt 4.3, S. 9.<br />
246 Vgl. Pawellek (1995), S. 75.<br />
247 Vgl. Abschnitt 3.5.4, S. 9.<br />
248 Vgl. Probst (1995), S. 181; Probst/Büchel (1994), S. 120.<br />
249 Zur Balance von stabilisierenden Elementen siehe Wolff (1982), S. 181 f.<br />
250 Siehe Abschnitt 4.2, S. 9.