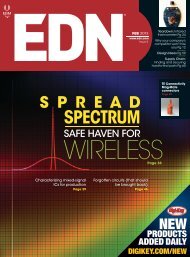DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abb.(Ausschnitt): Roger Viollet/StudioX; Fotos: M. Reichel/picture-alliace/dpa (l.); K. Kollwitz Museum, Köln (r.)<br />
17 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> No Drama im Bundestag:<br />
GESCHICHTE<br />
Am 1. Oktober 1982 wurde<br />
Helmut Kohl Kanzler S. 18<br />
<strong>39</strong><br />
Das Grab soll ausgehoben<br />
werden. So<br />
hat es der Stadtrat<br />
zu Hildburghausen<br />
im Thüringer<br />
Wald am 27. Juni dieses<br />
Jahres beschlossen, um endlich<br />
Gewissheit zu haben,<br />
um wen genau es sich bei<br />
der »Dunkelgräfin« handelt,<br />
die seit 1837 auf<br />
dem Stadtberg begraben<br />
liegt. Doch während<br />
die einen schon<br />
die Touristenbusse anrollen<br />
sehen und die<br />
Kassen klingeln hören,<br />
formieren sich andere<br />
zum Widerstand und<br />
fordern: Lasst sie ruhen!<br />
Wer nur war die geheimnisvolle<br />
Frau, die<br />
wegen ihrer grünen Brille<br />
und des Schleiers, der stets<br />
ihr Gesicht bedeckte, als<br />
»Dunkelgräfin« in die Geschichte<br />
eingegangen ist?<br />
Die Spur führt ins Paris der<br />
Revolution, ins Jahr 1795: Seit<br />
vier Jahren wird Marie Thérèse<br />
Charlotte de Bourbon, die 16-jährige<br />
Tochter des französischen Königs<br />
Ludwig XVI. und seiner Frau Marie<br />
Antoinette, im Temple gefangen gehalten.<br />
Sie hat hier die Hinrichtung ihrer Eltern und<br />
den Tod ihres Bruders miterleben müssen. Sie<br />
hat ein Jahr Einzelhaft hinter sich, umgeben<br />
von Soldaten, die, wie sie in ihrem Tagebuch<br />
schreibt, meist betrunken waren. Ob sie<br />
tatsächlich vergewaltigt wurde, lässt<br />
sich nicht sicher sagen. Aber es besteht<br />
kein Zweifel, dass die Haft<br />
dem jungen Mädchen schwere<br />
psychische Schäden zugefügt hat.<br />
Da die Prinzessin mehr und<br />
mehr zu einer Kultfigur der erstarkenden<br />
royalistischen Opposition<br />
wird, will die Revolutionsregierung<br />
sie so schnell<br />
wie möglich nach Österreich,<br />
in das Heimatland ihrer Mutter,<br />
abschieben. Andererseits<br />
befürchtet man, dass die Österreicher,<br />
mit denen sich die Franzosen<br />
damals noch im Krieg befinden,<br />
Marie Thérèse mit Erzherzog<br />
Karl, einem jüngeren Bruder<br />
des Kaisers, verheiraten könnten, um<br />
sich den Anspruch auf das Erbe der Prinzessin<br />
und auf den französischen Thron zu<br />
sichern. Ein Dilemma, aus dem es zunächst<br />
keinen Ausweg zu geben scheint.<br />
Offiziell wird die Prinzessin am 26. Dezember<br />
1795 in Basel an die österreichischen Behörden<br />
übergeben. Aber wie sagte Victor Hugo? »Es gibt<br />
zwei Arten von Geschichte: die offizielle, lügenhafte<br />
Geschichte und dann die geheime, wo die<br />
wahren Ursachen der Ereignisse liegen.« Die Geschichte<br />
der Tochter Marie Antoinettes ist dafür<br />
ein vollendetes Beispiel.<br />
Nach der offiziellen Geschichtsschreibung trifft<br />
sie Anfang Januar 1796 am Wiener Hof ein, wird<br />
freundlich aufgenommen und wie eine Tochter<br />
des Kaisers behandelt. 1799 heiratet sie ihren<br />
Cousin und lebt als Herzogin von Angou lême in<br />
Litauen und England – am Hof ihres Onkels,<br />
eines Bruders Ludwigs XVI. Nach der Vertreibung<br />
Napoleons kehrt dieser 1815 – als Ludwig XVIII.<br />
– mithilfe der Alliierten auf den wiedererrichteten<br />
französischen Königsthron zurück. Im Juli 1830<br />
aber kommt es zu einer erneuten Revolution in<br />
Paris und zur endgültigen Vertreibung der Bourbonen.<br />
Die Herzogin stirbt 1851 einsam und verbittert<br />
in Frohsdorf bei Wien.<br />
Die inoffizielle Version ist spektakulärer, nach<br />
neuesten Erkenntnissen aber die plausiblere.<br />
Das Grab<br />
im Wald<br />
Wer war die geheimnisvolle<br />
»Dunkelgräfi n« von<br />
Hildburghausen? Jetzt soll ihr<br />
Leichnam exhumiert werden<br />
VON CAROLIN PHILIPPS<br />
Schon im Januar 1796 schreibt Maria Karolina,<br />
Königin von Neapel und Schwester Marie Antoinettes:<br />
»Ich bin krank vor Angst, dass diese Bestien<br />
sich erlauben, ein anderes Mädchen anstelle meiner<br />
Nichte nach Wien zu schicken.« Und auch der englische<br />
Geheimagent Lord Wickham erhält von<br />
seinen Informanten beunruhigende Berichte von<br />
einer geplanten Flucht oder Entführung der Königstochter<br />
während ihres Aufenthalts in Basel. In<br />
den Archives nationales in Paris liegen zudem die<br />
Erpresserbriefe, die – Jahrzehnte später – eine ehemalige<br />
Untergouvernante an die Herzogin von<br />
Angoulême schreibt. In diesen Briefen droht sie<br />
damit, das Geheimnis der Vertauschung zu lüften.<br />
Bis zu ihrem Tod zahlt die Herzogin ein Vermögen<br />
an Schweigegeld.<br />
Die Korrespondenz belegt eindeutig, dass nicht<br />
die Tochter Marie Antoinettes in Wien angekommen<br />
ist, sondern ihre Halbschwester Marie<br />
Philippine, genannt Ernestine, eine uneheliche<br />
Tochter Ludwigs XVI. (Die Mutter ist eine seiner<br />
Kammerfrauen). Zusammen mit Marie Thérèse<br />
Marie Thérèse mit<br />
Bruder Louis<br />
Joseph, gemalt von<br />
Élisabeth Vigée-<br />
Lebrun 1787.<br />
Unten: Das Grab bei<br />
Hildburghausen<br />
wurde<br />
sie am Hof zu<br />
Versailles erzogen.<br />
Die Briefe, die Maria<br />
Karolina von Neapel zwischen 1796<br />
und 1799 an ihre Tochter, die österreichische<br />
Kaiserin, schickt, zeigen,<br />
dass man den Betrug in Wien<br />
schon sehr bald bemerkte. Das aber<br />
mochte niemand zugeben. Schließlich<br />
hatte der österreichische Unterhändler<br />
Dengelmann die Auslieferung<br />
der »richtigen« Königstochter<br />
offiziell quittiert – allerdings<br />
ohne sie jemals vorher gesehen zu<br />
haben. Es galt, das Gesicht zu wahren,<br />
wie Maria Karolina schrieb.<br />
Auch auf französischer Seite bemühte<br />
man sich um Geheimhaltung: An der Vertauschung<br />
beteiligt waren unter anderem Paul<br />
de Barras, der als Mitglied des Direktoriums für<br />
das Polizeiwesen zuständig war, und der Innenminister<br />
Pierre Bénézech. Sie gingen damit ein<br />
hohes Risiko ein. Wenn die Sache zum falschen<br />
Zeitpunkt aufflog, konnte dies nicht nur die<br />
Karriere der Beteiligten ruinieren, sondern auch<br />
die Beziehungen der französischen Regierung<br />
zum Hause Habsburg und zu anderen Herrscherhäusern.<br />
Immerhin war der Austausch ein<br />
offizieller Akt zwischen zwei Regierungen; das<br />
noch zweifelhafte Ansehen der Französischen<br />
Republik als Verhandlungspartner wäre auf lange<br />
Sicht zerstört worden.<br />
Als eines der größten Probleme erwies sich<br />
dabei die Unterbringung der echten Prinzessin.<br />
Niemand wusste, wie lange sie untertauchen musste.<br />
Und wann und ob man sich ihrer dereinst als<br />
Trumpfkarte bedienen würde – in dem Fall etwa,<br />
dass die Habsburger tatsächlich versuchen sollten,<br />
über eine Heirat Ansprüche auf den französischen<br />
Thron geltend zu machen.<br />
In diesen Zeiten der nachrevolutionären Kriege,<br />
die ganz Europa überzogen, gab es nur eine<br />
Institution, die überregional, politisch unabhängig<br />
und frei von gesellschaftlichen und religiösen<br />
Schranken agierte: die der Freimaurer. Es geht hier<br />
nicht um irgendeine der vielen Verschwörungstheorien,<br />
die den Freimaurern gerade in Zusammenhang<br />
mit der Französischen Revolution<br />
fälschlicherweise angehängt wurden<br />
und werden. Es geht hier allein um ihr<br />
Netzwerk, das einzigartig war – um 1790<br />
existierte beiderseits des Rheins in fast<br />
jeder größeren Stadt mindestens eine<br />
Freimaurerloge. Zudem waren alle an<br />
der Vertauschung Beteiligten Freimaurer,<br />
von den Regierungsmitgliedern<br />
Barras und Bénézech bis<br />
zu den französischen Gesandten<br />
in Basel.<br />
In den Jahren nach 1796 wird die<br />
echte Marie Thérèse immer wieder<br />
an verschiedenen Orten gesehen,<br />
mal in Straßburg, mal im<br />
schwäbischen Ingelfingen. Wegen<br />
der großen Ähnlichkeit zwischen<br />
ihr und ihrer Halbschwester<br />
glauben die Menschen, sie hätten<br />
die Herzogin von Angoulême vor<br />
sich. Die aber lebt zu dieser Zeit<br />
längst viele Tausend Kilometer entfernt<br />
in Litauen.<br />
Von 1799 an sorgt Leonardus Corne<br />
lius van der Valck, vormals<br />
holländischer Gesandter in<br />
Paris, für den Schutz der<br />
Prinzessin – vermutlich im<br />
Auftrag des französischen<br />
Innenministers Talleyrand<br />
(der ebenfalls den<br />
Freimaurern angehört).<br />
1807 erscheinen van der<br />
Valck und Marie Thérèse<br />
schließlich im thüringischenHildburghausen,<br />
wo Herzog Karl von<br />
Mecklen burg-Strelitz Meister<br />
vom Stuhl der Freimaurerloge<br />
»Karl zum Rautenkranze« ist<br />
und seine Tochter Charlotte amtierende<br />
Herzogin. Zwischen der Herzogsfamilie und Marie<br />
Antoinette hat zu deren Lebzeiten eine intensive<br />
Freundschaft bestanden.<br />
Hier findet Marie Thérèse endlich ihren Frieden,<br />
so wie sie es sich gewünscht hat, als sie noch<br />
im Gefängnis saß: »Ich schließe manchmal meine<br />
Augen und denke mir, dass ich in einem einsamen<br />
Schlosse wohne, umgeben nur von einigen treuen<br />
Menschen, die mich ebenso lieben wie ich sie [...],<br />
und dass die Menschen, denen ich begegne, gar<br />
nicht ahnen, wer ich bin.« Die Gerüchteküche<br />
allerdings brodelt schon damals, aber van der Valck<br />
besitzt genügend Geld, um die Anonymität seiner<br />
Begleiterin zu wahren. 1837 stirbt die »Dunkelgräfin«<br />
und wird auf dem Stadtberg oberhalb von<br />
Hildburghausen begraben.<br />
Da alle, die von der Vertauschung wussten, es<br />
tunlichst vermieden, schriftliche Spuren zu hinterlassen,<br />
bleiben für Skeptiker bis heute Fragen<br />
offen. Deshalb soll jetzt, 175 Jahre später, eine<br />
DNA-Analyse klären, ob die »Dunkelgräfin« tatsächlich<br />
die Tochter Ludwigs XVI. war. Eine Bürgerinitiative<br />
hat erreicht, dass die Hildburghausener<br />
zuvor abstimmen dürfen, ob die Leiche der Gräfin<br />
ans Licht gezerrt werden soll. Doch abgesehen von<br />
der ethischen Frage, ob neue Erkenntnisse um den<br />
Preis der Totenruhe gewonnen werden sollten, ist<br />
es auch zweifelhaft, ob dies überhaupt Klarheit<br />
bringen würde. Der Stadtberg war zwischen 1967<br />
und 1991 Sperrgebiet der sowjetischen Armee.<br />
Ältere Hildburghausener berichten, dass das Grab<br />
in dieser Zeit geöffnet worden sei – womöglich<br />
suchte man nach wertvollen Beigaben. Die Untersu<br />
chung eines bereits unkontrolliert geöffneten<br />
Gra bes kann aber kaum den Ansprüchen der Wissenschaft<br />
genügen. So wird, wie immer die Bürger<br />
entscheiden, der Schatten eines Zweifels bleiben,<br />
wer die geheimnisvolle »Dunkelgräfin« wirklich war.<br />
Die Autorin ist Historikerin und lebt in Hamburg.<br />
Mehr zum Thema in ihrem Buch »Die Dunkelgräfin.<br />
Das Geheimnis um die Tochter Marie Antoinettes«,<br />
das im April erschienen ist (Piper Verlag; <strong>39</strong>3 S., 10,99 €)<br />
Porträt der Epoche<br />
In Köln sind die faszinierenden Fotos<br />
der Lotte Jacobi zu sehen<br />
Was für eine gloriose Reihe: Marianne Breslauer, Ilse<br />
Bing, Yva, Gisèle Freund, Ger maine Krull, Aenne<br />
Biermann, Ruth Hallensleben, Frieda Riess, Suse<br />
Byk, Lucia Moholy ... und so viele Fotografinnen<br />
mehr, die als junge Frauen in der Weimarer Republik<br />
Furore und Fotogeschichte machten. Zu dieser Generation<br />
gehört auch Lotte Jacobi, Tochter einer<br />
Fotografenfamilie, 1896 in Thorn an der Weichsel<br />
geboren. Eigentlich wollte sie weg vom Gewerbe der<br />
Alten, wollte Imkerin werden und alles Mögliche<br />
andere. Aber dann erlag sie doch dem angeborenen<br />
Talent, stieg in das väterliche Unternehmen ein, das<br />
nach dem Ersten Weltkrieg nach Berlin umgezogen<br />
war – und wurde eine der Großen ihrer Zunft.<br />
Das Käthe Kollwitz Museum in Köln zeigt jetzt<br />
mehr als 100 Bilder Jacobis, in denen sich die Geschichte<br />
des 20. Jahrhunderts spiegelt. Im Mittelpunkt<br />
die Porträts aus dem Deutschland der Zwanzi<br />
ger, sowohl Auftragswerke als auch Pressefotos.<br />
Ikonen der Fotokunst sind darunter wie ihre Bildnisse<br />
von Lotte Lenya, Karl Valentin, Käthe Kollwitz,<br />
Klaus und Erika Mann oder der Tänzerin<br />
Niura Nor skaya von 1929 (unser Bild oben). Daneben<br />
stehen ihre Reportagen aus der Sow jet union<br />
der frühen drei ßiger Jahre, ihre Arbeiten aus dem<br />
amerikanischen Exil (Thomas Mann und Albert<br />
Einstein in Prince ton, 1938) und aus ihren späteren<br />
Jahren in den USA, wo sie 1990 auch gestorben ist.<br />
»Mein Stil ist der Stil der Menschen, die ich photographiere«,<br />
hieß eine ihrer Maximen – ein Bekenntnis<br />
zum Individualismus in einer brutalen Epoche,<br />
die auf den Einzelnen keine Rücksicht nahm.<br />
Käthe Kollwitz Museum, bis zum 25. November;<br />
Köln, Neumarkt 18–24; Tel. 0221/227 28 99<br />
<strong>ZEIT</strong>LÄUFTE<br />
SCHAUPLATZ: KÖLN<br />
onfession macht kitzelig. Ein böser Zank<br />
K<br />
um archaische Riten, ein zotiges Filmchen<br />
im Internet, die hämische Erinnerung an<br />
die Niederlage auf irgendeinem irischen<br />
Schlachtfeld vor 300 oder 500 oder 10 000 Jahren<br />
– schon ist der Fromme entflammt, schon rast der<br />
beleidigte Glaube, das religiöse Gefühl.<br />
Ganz anders hingegen das demokratische Staatsbürgertum!<br />
Da werden unsere Par lamen ta rier in<br />
den Untersuchungsausschüssen zum Naziterror des<br />
NSU, da wird die ganze Republik seit einem Jahr<br />
von sogenannten Verfassungsschützern, von Innenministerien,<br />
von Bundeswehrstellen und Polizeibehörden<br />
nach Strich und Faden verhöhnt und zum<br />
Narren gehalten – aber alles bleibt gleichmütig und<br />
sanft, und selbst in unseren unbestechlichen Medien<br />
flötet es nur fröhlich von »Pannen«. Da wurde<br />
»vergessen« und »verlegt«, da werden, so scheint es,<br />
mutmaßliche Mordkumpane aus den Amtsstuben<br />
heraus gedeckt, doch niemand fühlt sich beleidigt,<br />
niemand demonstriert.<br />
Wie gut, dass Demokratie nur irgendeine Staatsform<br />
ist, dass sie keine religiösen Gefühle weckt.<br />
Und dass niemand an sie glaubt. B.E.



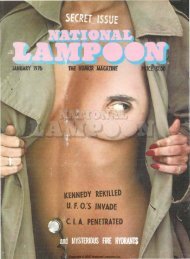

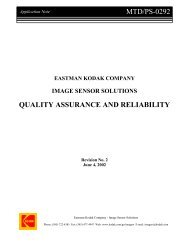
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

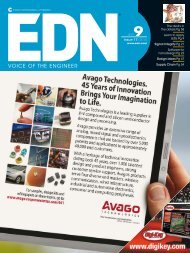

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)