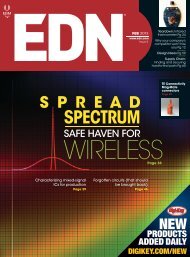DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FEUILLETON<br />
Vom Star<br />
zum Opfer<br />
im Netz<br />
Die Kommunikation im Internet ist voller<br />
Fallen. Selbst die Piratenpolitikerin Julia<br />
Schramm verfi ng sich darin VON JENS JESSEN<br />
Das Internet ist ein gefährlicher<br />
Ort. Selbst Menschen,<br />
die das Netz als ihren natürlichen<br />
Lebensraum betrachten,<br />
können darin scheitern,<br />
wie das Beispiel der Piratenpolitikerin<br />
Julia Schramm<br />
zeigt. Ihr Schiffbruch offenbart einen Selbstwiderspruch,<br />
den weder die Sphäre des Web noch die der<br />
Politik verzeihen kann: Sie hat ihr eigenes Medium<br />
nicht verstanden.<br />
»Mein Name ist Julia, und ich lebe im Internet.<br />
Ich bin da ziemlich glücklich, habe Freunde, die<br />
ich nur digital kenne und abschalten kann, wann<br />
ich will.« Mit dieser Idylle beginnt ein autobiografisches<br />
Buch, das sie dieser Tage veröffentlicht hat<br />
– aber unglückseligerweise in traditionell verlegter<br />
Form, zum Kaufen im Buchhandel, und nicht<br />
etwa als Datei zum kostenlosen Download im<br />
Netz, wie es die Autorin eigentlich hätte machen<br />
müssen. Denn Julia Schramm ist eine bekennende<br />
Verächterin des Urheberrechts, eine der radikalsten<br />
und prominentesten, sie fände geistiges Eigentum<br />
»ekelhaft«, äußerte sie einmal. Was will sie<br />
dann im Verlagsgeschäft? Um den Widerspruch<br />
auf die Spitze zu treiben, haben ihre Freunde im<br />
Netz jetzt eine Datei des Buches zur freien Raubkopie<br />
bereitgestellt. Und was tun Julia Schramm<br />
und ihr Verlag? Sie lassen die Datei so schnell wie<br />
möglich verschwinden und bedrohen jeden mit<br />
Abmahnung, der von ihr Gebrauch machen sollte,<br />
falls sich eine Kopie noch irgendwo finden sollte<br />
– was im Labyrinth des Netzes mehr als wahrscheinlich<br />
ist.<br />
Schneller dürfte politische Glaubwürdigkeit noch<br />
nie verspielt worden sein. Jetzt wird sich zeigen, wie<br />
das mit dem Glück und den Freunden im Internet<br />
ist – das heißt, wer wen abschaltet, wenn er den nötigen<br />
Verdruss verspürt. Klick mich heißt der neckische<br />
Titel von Julia Schramms Buch, und der Aufforderung<br />
werden gewiss viele nachkommen: zum<br />
Wegklicken. Der Gerechtigkeit halber muss man allerdings<br />
sagen, dass Personen der Öffentlichkeit sich<br />
schon vor Erfindung des Netzes in gefährliche Selbstwidersprüche<br />
verstrickt haben. Cicero, einer der<br />
berühmtesten Politiker und Autoren der Antike,<br />
wechselte zwischen den Protagonisten des römischen<br />
Julia Schramm, erklärte Feindin des Urheberrechts. Ihr Verlag geht gegen Raubkopien ihres Buches vor<br />
Bürgerkrieges, zwischen Marc Anton und Octavian,<br />
so lange hin und her und hielt für jedes der Lager so<br />
eindrucksvolle, tief überzeugte Reden, dass schließlich<br />
jede Autorität dahin war. Themistokles, der<br />
glänzende Verteidiger athenischer Freiheit gegen die<br />
persische Monarchie, lief am Ende seines Lebens zum<br />
Großkönig über – was ihn in der griechischen Öffentlichkeit<br />
vom demokratischen Freiheitshelden zum<br />
Hasardeur, wenn nicht Lakaien machte.<br />
Seitenwechsel sind in der Politik nicht immer<br />
tödlich – aber immer dann, wenn die Sache der einen<br />
Seite mit einem Maß an ideologischer Überhöhung<br />
vertreten wurde, dass der Übertritt ins andere Lager<br />
nicht mehr als taktisch, noch nicht einmal als opportunistisch,<br />
sondern als blanker Verrat, als Ausweis<br />
bodenloser Charakterlosigkeit erlebt wird. Angela<br />
Merkel, deren Hin und Her in der Finanzkrise gewiss<br />
nicht prinzipienfest war, hat es doch klug vermieden,<br />
jemals irgendeine ihrer vorübergehenden Positionen<br />
ideologisch zu begründen. Das war schlimm in den<br />
Augen ihrer Kritiker, die Prinzipientreue gerne hätten<br />
– aber nicht schlimm für sie, die etwas anderes als<br />
Pragmatismus niemals versprach.<br />
Und vor allem: Das Drama der Merkelschen<br />
Krisenbewältigung wird<br />
nicht im Netz uraufgeführt. Es spiegelt<br />
sich nur dort – wie sich alles im<br />
Netz spiegelt. Das ist ein bedeutender<br />
Unterschied. Angela Merkel kann sich an die<br />
üblichen politischen Teilöffentlichkeiten wenden,<br />
an das Parlament, das Kabinett, die Partei; an das<br />
Plenum internationaler Gipfeltreffen oder kaum<br />
sichtbare Diplomatenkreise; schließlich auch an<br />
eine allgemeine, aber immer medial vermittelte<br />
Öffentlichkeit, sieht man von ihrem Podcast einmal<br />
ab. Mit anderen Worten: Es sind deutlich verschiedene,<br />
voneinander abgegrenzte Sprechakte, je<br />
nach Publikum und Adressat, und selbst Botschaften<br />
direkt ans Volk haben ihre eigentümliche, definierte<br />
Form wie in den Weihnachtsansprachen<br />
oder werden von Journalisten übermittelt, also gewohnheitsmäßigen<br />
Übersetzern.<br />
Nirgendwo schießen diese Sprechakte unvermittelt<br />
zusammen oder treffen auf ungeübte Ohren.<br />
Sie verlieren auch ihre zeitliche Ordnung<br />
nicht. Es gibt nur einen Ort, wo dies geschehen<br />
könnte – wo nicht mehr kalkulierbar ist, zu wem<br />
man spricht, und wo Entstehung und Zeit einer<br />
Wortmeldung unsichtbar werden: Das ist das Internet.<br />
Man überlege sich nur einmal, was im Netz<br />
mit dem politischen Denker Heinrich Heine geschehen<br />
wäre, dessen Position sich im Laufe seines<br />
Lebens vom Demokraten zum Kommunisten und<br />
schließlich Monarchisten wandelte. Jede Phase<br />
seines Denkens hätte die andere unrettbar denunziert,<br />
obwohl Jahrzehnte zwischen ihnen lagen<br />
und Heines charakteristische Dialektik im Übrigen<br />
auch nahelegte, jeweils eine Gegenposition zur<br />
herrschenden Meinung zu artikulieren.<br />
Heinrich Heine, der bedeutendste Gesellschaftskritiker<br />
vor Marx und Nietzsche, wäre im Netz nichts<br />
als eine verlachte Hassfigur – wenig mehr als eine<br />
Julia Schramm, die gestern das Urheberrecht verachtet<br />
und heute die Profite daraus sichern möchte.<br />
Nun wird man zugeben müssen, dass Schramm ihre<br />
Positionen auch nach Maßstäben der Dialektik deutlich<br />
zu rasch und unvermittelt gewechselt hat. Aber<br />
in einer anderen Kommunikationsumgebung hätte<br />
man doch von gewandelter Einsicht sprechen können<br />
oder sogar eine Unterscheidung gemacht zwischen<br />
der politischen Person und der Geld verdienenden<br />
Privatperson – vielleicht jedenfalls.<br />
Das eigentliche Dilemma des Netzes besteht in<br />
seiner grenzenlosen, für niemanden einschätzbaren<br />
Öffentlichkeit. Wer im Netz spricht, weiß niemals,<br />
zu wem er spricht – von klar eingegrenzten Foren<br />
einmal abgesehen. Gibt es Kenntnisse, Einsichten,<br />
moralische Maßstäbe, gar Ironiefähigkeit oder Bildung?<br />
Es gibt sie natürlich – und es gibt sie natürlich<br />
nicht. Wer das Wesen seines Adressaten nicht kennt,<br />
kann aber keinen sinnvollen Satz formulieren. Was<br />
dem einen als selbstverständlich, fast als Plattitüde<br />
erscheint, kann schon dem nächsten Tränen des Zorns<br />
in die Augen treiben. Man äußere nur einmal im Netz,<br />
dass Norwegen oder die Ukraine künstlich geschaffene,<br />
auf wackliger Grundlage erfundene Nationen<br />
ohne Tradition seien – es würde bei jedem Historiker,<br />
auch bei jedem historisch gebildeten Norweger oder<br />
Ukrainer nur müde Zustimmung, aber bei allen<br />
naiven Patrioten Wutschreie provozieren.<br />
Nicht nur die Welt als Ganze, auch jede Nation<br />
und jede Stadt besteht aus zahllosen Parallelgesellschaften,<br />
deren Denkhorizonte nicht ohne bizarre<br />
LITERATUR<br />
Ulf Erdmann Zieglers Roman<br />
»Nichts Weißes« S. 47<br />
Missverständnisse und tiefe Kränkungen zusammengeführt<br />
werden können. Nur ein besonders trauriges<br />
Beispiel ist das antimohammedanische Video, das<br />
derzeit sein Hasspotenzial vom Internet hinaus auf<br />
die Straße trägt, aber für ein westliches Publikum nur<br />
eine Albernheit darstellt, während es die islamische<br />
Welt ganz ernsthaft ins Mark trifft. Mit guten Gründen<br />
haben die traditionellen Medien, die regional<br />
begrenzten Sender und Zeitungen, stets nur Teilöffentlichkeiten<br />
bedient – die Parallelgesellschaften<br />
der Welt abgebildet.<br />
Natürlich kann es seinen Witz, mitunter<br />
auch eine lehrreiche Pointe<br />
haben, wenn die Mauern zwischen<br />
Milieus eingerissen werden – und<br />
die Welt erfährt, wie der amerikanische<br />
Präsidentschaftskandidat Romney im kleinen<br />
Kreis die Wähler seines Kontrahenten Obama<br />
beschimpft, die er eigentlich für sich gewinnen<br />
müsste. Aber was folgt daraus? Mitt Romney hat<br />
den Sprechakt gewählt, der dem kleinen Kreis von<br />
Anhängern vielleicht sehr angemessen war – nur<br />
eben nicht geeignet, heimlich mitgefilmt und ins<br />
World Wide Web gepustet zu werden. Nüchtern<br />
gesehen, war sein Fehler nur, die jederzeit mögliche<br />
und tödliche Denunziation im Netz nicht einkalkuliert<br />
zu haben.<br />
Auf der Überschreitung von Milieugrenzen, die<br />
in den traditionellen Medien selbstverständlich bestanden,<br />
beruhte auch die Aufregung über die<br />
Nacktfotos von Kate Middleton. In der Schmuddelpresse<br />
mit ihrem Schmuddelpublikum hätten sie<br />
ihren rechten Ort gehabt und vielleicht nur einen<br />
kleinen Prozess nach sich gezogen, der zur Feier<br />
solcher Indiskretion gehört. Erst die Präsentation<br />
vor dem unspezifischen Publikum des Internets<br />
konnte den Gedanken der Majestätsbeleidigung<br />
aufkommen lassen. Niemand weiß, wie die Fotos<br />
dort gelesen werden, mit einem Augenzwinkern<br />
oder dem dramatischen Verlust jeden Respekts vor<br />
der Monarchie.<br />
Die Revolution einer Weltöffentlichkeit, die das<br />
Internet geschaffen hat, wird Jahrzehnte, wenn nicht<br />
Jahrhunderte brauchen, um aufgeklärte, tolerante<br />
Formen des Gesprächs zu entwickeln, das nicht Hass<br />
und Missgunst jederzeit fürchten muss.<br />
Foto (Ausschnitt): Hermann Bredehorst/Polaris/laif<br />
GLAUBEN & ZWEIFELN<br />
Blasphemie: Ein Gespräch mit Seyran Ates<br />
über Demokratie und religiöse Gefühle S. 58<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 43<br />
HASS-VIDEO<br />
Falsche Bärte<br />
Was zeigt der Schmähfilm gegen<br />
Mohammed eigentlich?<br />
Jeder kennt diese scheinbar von einem Nichts<br />
ausgelösten Familienstreite, die zu Türenknallen,<br />
Geschrei, ja sogar panischen Fluchten<br />
im Auto eskalieren. Nach einer Weile,<br />
wenn alle heiser geschrien wieder zusammenkommen,<br />
fragt man sich, was zum Teufel eigentlich<br />
der Auslöser war. Zwei der schlimmsten<br />
Streite unserer Familie wurden ausgelöst<br />
von einer roten Socke, die meine Schwester<br />
oder ich aus Versehen in die Kochwäsche geworfen<br />
hatte, und von einem unter den Teller<br />
geklebten Kaugummi.<br />
Es ist nicht zynisch, die Ausschreitungen<br />
der Muslime in aller Welt aus einem analogen<br />
Blickwinkel zu betrachten. Es ist nicht<br />
zynisch, weil der Konflikt ganz offenkundig<br />
nur einen beliebigen, ja regelrecht abseitigen<br />
Auslöser brauchte, um sich in stereotyper<br />
Weise zu entfalten. Wer sich den sogenannten<br />
Mohammed-Schmähfilm The Innocence<br />
of Muslims als Kurzversion im Internet anschaut,<br />
der sieht: Menschen mit angeklebten<br />
Bärten, die in eine Art digitale Wüstentapete<br />
montiert sind. Männer in scheichartigen<br />
Gewändern (die es in Berlin bei Deko-Behrend<br />
in besserer Qualität gibt), die mit<br />
Schwertern herumfuchteln. Einen Typen namens<br />
Mohammed, der sich mit einem Straßenjungen<br />
um einen abgenagten Knochen<br />
streitet, seinen Kopf linkisch zwischen die<br />
Beine einer Frau steckt, alle weiblichen Wesen<br />
in seiner Umgebung ins Bett zieht und<br />
auf debile Weise zum Feldzug gegen Christen<br />
aufruft. Das Ganze, man muss es einfach<br />
sagen, sieht aus, als habe Otto Waalkes den<br />
Koran gelesen und nach einer Wasserpfeife<br />
einen Trailer für 7 Zwerge – Männer allein in<br />
der Wüste gedreht. Oder als habe sich eine<br />
Laienspielgruppe in der deutschen Provinz<br />
nach ein paar Kästen Bier vorgenommen, bei<br />
den Passionsspielen mal was richtig Abgefahrenes<br />
zu machen.<br />
Es nimmt nicht weiter Wunder, dass für<br />
den Dreh des Films ein Trash-und-Porno-<br />
Regisseur mit dem Pseudonym Alan Roberts<br />
verantwortlich zeichnet (seine weiteren<br />
Werke sind: Zombie-Kriege, Die glückliche<br />
Nutte geht nach Hollywood). Der Internetclip<br />
ist ja tatsächlich ein Pornofilm, ein<br />
schmutziges, kleines, blödes Werk mit Alibihandlung,<br />
das möglichst umstandslos<br />
zum Ziel kommt. Die einstündige Langfassung<br />
wurde bisher nur einmal, vergangenen<br />
Juni, in einem halb leeren Kino in Hollywood<br />
gezeigt, ohne dass sich irgendjemand<br />
darüber aufgeregt hat.<br />
Was heißt das? Dass es rein gar nichts<br />
bringen kann, hinter den teilnahmslos in die<br />
Wüste blickenden Kamelen und Blechsäbeln<br />
von The Innocence of Muslims nach Gründen<br />
für die Hassausbrüche und die Toten der<br />
letzten Tage zu suchen. Dass den Ernst der<br />
Lage zu erkennen gerade bedeuten kann, den<br />
Auslöser nicht zu ernst zu nehmen. Und dass<br />
es eine Irreleitung wäre, den Clip durch ein<br />
Verbot noch weiter aufzuwerten und zu dämonisieren.<br />
Man wird unzählige Werke finden<br />
können, die mit den vielschichtigen Ursachen<br />
der arabischen Unruhen zwar nichts<br />
zu tun haben, aber mühelos für weitere Mobilmachungen<br />
instrumentalisiert werden<br />
können. Genauso gut könnte man rote Socken<br />
verbieten. KATJA NICODEMUS



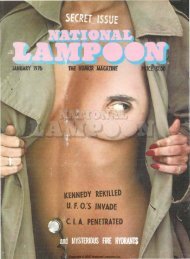

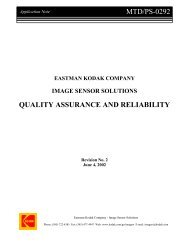
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

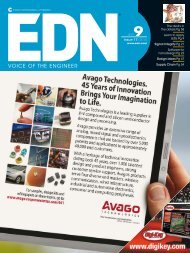

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)