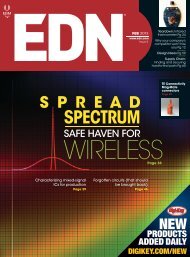DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
CHANCEN HOCHSCHULE<br />
Globuli-<br />
Akademie<br />
Über die Gründung privater Hochschulen<br />
erlangen Pseudowissenschaften<br />
höhere Weihen VON BERND KRAMER<br />
In diesen Tagen ist die Freude in Traunstein<br />
groß. Die 18 000-Einwohner-Stadt in<br />
Oberbayern bekommt bald eine eigene<br />
Hochschule. Bloß was für eine? Im Ort soll<br />
die erste europäische Hochschule für Homöopathie<br />
eröffnen, getragen von der European<br />
Union of Homoeopathy, einem Lobbyverband<br />
der Alternativmedizin aus Freiburg. Die ersten<br />
Studenten werden im kommenden Jahr erwartet.<br />
Eines Tages sollen sie als Homöopathen mit<br />
Bache lor- und Mastergrad abschließen. Über das<br />
genaue Konzept hüllen sich die Hochschulgründer<br />
noch in Schweigen. Die Lokalpolitik ist dafür<br />
umso begeisterter: Einstimmig begrüßte der<br />
Kreisausschuss das Vorhaben. Landrat Hermann<br />
Steinmaßl sieht in der Homöopathie-Hochschule<br />
gar einen »wichtigen Baustein für die Bildung<br />
und die medizinische Versorgung im Landkreis«.<br />
Kritik? Fehlanzeige.<br />
Es wirkt wie ein Schildbürgerstreich: Was die<br />
Wissenschaft als wirkungsloses Therapieverfahren<br />
ad acta gelegt hat, blüht in der bayerischen<br />
Provinz wieder auf. Unzählige Studien zeigen,<br />
dass homöopathische Mittel nicht besser helfen<br />
als ein Placebo. Mit privatem Geld lässt sich um<br />
ein spekulatives Verfahren herum aber offenbar<br />
ohne großen Widerstand eine Hochschule bauen.<br />
Wie kann das sein?<br />
Der Traunsteiner Fall zeigt eine Entwicklung,<br />
die sich auch andernorts abzeichnet. Die Zahl<br />
der privaten Hochschulen ist in den vergangenen<br />
Jahren förmlich explodiert und hat sich in den<br />
letzten zehn Jahren verdoppelt. 2000 boten erst<br />
47 Privathochschulen ihre Dienste auf dem<br />
deutschen Markt an. Jetzt sind es schon 108. Die<br />
privaten machen damit inzwischen rund ein<br />
Viertel aller Hochschulen aus. Der Wissenschaftsrat,<br />
das wichtigste Beratungsgremium der<br />
Politik in Fragen von Forschung und Lehre, sieht<br />
die Entwicklung positiv: Die privaten Anbieter<br />
böten oft Beispiele für die »erfolgreiche Akademisierung<br />
bisher nicht akademischer Berufe«,<br />
vor allem im Bildungs- und Gesundheitsbereich,<br />
wo sie erste Studiengänge für angehende Erzieher<br />
oder Krankenpfleger schaffen und damit oft zu<br />
Vorreitern werden. Einer Studie zufolge, die der<br />
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft<br />
und die Unternehmensberatung McKinsey 2010<br />
vorlegten, locken die Privathochschulen mit der<br />
Aufwertung früherer Ausbildungsberufe gerade<br />
die Bevölkerungsschichten in die Hörsäle, die<br />
bislang nicht studierten. Doch diese Akademisierung<br />
hat Schattenseiten: Private Hochschulen<br />
lehren auffällig oft wissenschaftlich fragwürdige<br />
Inhalte – ohne dass sie bislang allzu viel zu befürchten<br />
hätten.<br />
Eine inhaltliche Prüfung des<br />
Angebots findet nicht statt<br />
Die Berliner Steinbeis-Hochschule bietet beispielsweise<br />
Studiengänge in Komplementärmedizin an,<br />
ebenso wie die Fresenius-Hochschule in Idstein und<br />
die Berliner Hochschule für Gesundheit und Sport.<br />
An der anthroposophischen Alanus-Hochschule in<br />
Alfter bei Bonn kann man sogar einen Bachelor in<br />
Eurythmie machen. »Was sich im staatlichen System<br />
nicht unterbringen lässt, schmuggelt man in<br />
privat organisierte Hochschulen hinein«, kritisiert<br />
Martin Mahner von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen<br />
Untersuchung von Parawissenschaften.<br />
Nach den wilden Gründerjahren haben sich die<br />
Kultusminister im Jahr 2004 darauf verständigt,<br />
dass neue Privathochschulen vom Wissenschaftsrat<br />
begutachtet werden sollen, ehe sie eine staatliche<br />
Anerkennung erhalten. Diese sogenannte institutionelle<br />
Akkreditierung privater Hochschulen solle<br />
»möglichst vor Betriebsaufnahme, aber spätestens<br />
vor der endgültigen Anerkennung durch die Länder«<br />
geschehen, so die Empfehlung der Kul tusminis<br />
ter kon fe renz. Im Akkreditierungsverfahren<br />
prüfen Experten des Wissenschaftsrates das Konzept,<br />
die Finanzen, das Personal, Betreuungsrelationen<br />
und Lehrpläne; sie besuchen die Hochschulen<br />
und begutachten Raumausstattung und<br />
die Bestände der Bibliotheken. Der Wissenschaftsrat<br />
bezeichnet die institutionelle Akkreditierung<br />
als »Verfahren der Qualitätssicherung, das<br />
klären soll, ob eine Hochschuleinrichtung in der<br />
Lage ist, Leistungen in Lehre und Forschung zu<br />
erbringen, die anerkannten wissenschaftlichen<br />
Maßstäben entsprechen«.<br />
Studium für Alternativmediziner? In Traunstein soll eine Hochschule für Homöopathie entstehen<br />
Geprüft wird in der Tat ziemlich viel – bloß<br />
bemängeln Kritiker, dass im Akkreditierungsverfahren<br />
lediglich formale Aspekte im Vordergrund<br />
stünden. »Eine inhaltliche Prüfung im ei gentlichen<br />
Sinne findet kaum statt«, sagt Matthias<br />
Jaroch, Sprecher des Deutschen Hochschulverbandes.<br />
»Die Akkreditierung ist weitgehend eine<br />
formale Kontrolle. Man kann sich natürlich fragen,<br />
was der Sinn des Ganzen ist. Da wird ein<br />
Siegel vergeben, das eigentlich nichts aussagt.«<br />
Auch die Hochschulforscherin Margret Bülow-<br />
Schramm von der Uni Hamburg bemängelt, im<br />
Akkreditierungsprozess sei die »Fachlichkeit generell<br />
unterbelichtet«.<br />
Bislang hat der Wissenschaftsrat erst einen Teil<br />
der Privathochschulen geprüft. 58 Einrichtungen<br />
hat er sein Okay gegeben, lediglich acht Hochschulen<br />
bekamen die Akkreditierung nicht.<br />
Einer der wenigen Fälle, in denen der Wissenschaftsrat<br />
aus inhaltlichen Zweifeln einem<br />
Angebot die Akkreditierung verweigerte, ist die<br />
anthroposophische Freie Hochschule Mannheim,<br />
die Bachelor- und Mastergrade in Waldorfpädagogik<br />
vergeben wollte. Das Urteil des<br />
Wissenschaftsrates fiel hart aus: Das Institut erreiche<br />
auf »einer grundsätzlichen Ebene nicht<br />
die für eine Hochschule erforderliche Wissenschaftlichkeit«,<br />
schrieben die Gutachter in ihrer<br />
Entscheidung aus dem Januar 2011. »Dies betrifft<br />
die Vielfalt methodischer Ansätze und den<br />
Anspruch, den in den Erziehungswissenschaften<br />
üblichen Standards gerecht zu werden.<br />
Ohne eine solche Klärung besteht jedoch die<br />
Gefahr, eine spezifische, weltanschaulich geprägte<br />
Pädagogik im Sinne einer außer wissenschaft<br />
lichen Erziehungslehre zur Grundlage einer<br />
Hochschuleinrichtung zu machen.« Im<br />
Klartext: Waldorfpädagogik ohne ein Minimum<br />
an erziehungswissenschaftlicher Grundbildung<br />
ist akademischer Weihen nicht würdig.<br />
Die Freie Hochschule Mannheim nennt sich<br />
seither »Akademie für Waldorfpädagogik« – was<br />
akademisch klingt, es aber nicht ist. Im Gegensatz<br />
zu »Hochschule« ist die Bezeichnung »Akademie«<br />
nicht geschützt. Den Bachelorstudiengang<br />
gibt es nach wie vor: Mit einem Trick wird<br />
»Die Mediziner sind am schnellsten«<br />
Wann gründen Absolventen eine Familie? Ein Interview mit der Hochschulforscherin Gesche Brandt<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: In Ihrer Studie, die diese Woche erscheint,<br />
haben Sie untersucht, wie Hochschulabsolventen<br />
Berufstätigkeit und die Gründung<br />
einer Familie vereinbaren. Wann bekommen<br />
denn die meisten Absolventen das erste Kind?<br />
Gesche Brandt: Die wenigsten bekommen gleich<br />
nach dem Studium Kinder, mit zunehmendem<br />
Abstand vom Abschluss steigt die Anzahl der Eltern.<br />
Wir haben rund 5400 Absolventen des<br />
Jahrgangs 1997 befragt, zu verschiedenen Zeitpunkten.<br />
Ein Jahr nach dem Studium haben 13<br />
Prozent der Frauen ein Kind, nach fünf Jahren<br />
37 Prozent und nach zehn Jahren haben 62 Prozent<br />
der Absolventinnen Kinder.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Bleiben Akademikerinnen eher kinderlos<br />
als andere Frauen?<br />
Brandt: Der Anteil kinderloser Frauen ist bei<br />
Hochschulabsolventinnen etwas größer als in anderen<br />
Bildungs- oder Berufsgruppen. Man kann<br />
aber nicht sagen, dass 40 Prozent ohne Kinder<br />
bleiben, rund die Hälfte der bisher kinderlosen<br />
Absolventinnen möchte noch Kinder bekommen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen<br />
Fachrichtungen? Bekommen Biologen eher<br />
Kinder als zum Beispiel Informatiker?<br />
Brandt: Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen<br />
den Fachrichtungen. Bei den Absolventen<br />
von Medizin, Psychologie, Pädagogik und Sozialwesen<br />
wird jeder zweite bereits in den ersten fünf<br />
Jahren nach dem Studium Mutter<br />
oder Vater. Andere Hochschulabsolventen,<br />
für die es länger<br />
dauert, sich beruflich zu etablieren,<br />
zögern das Kinderkriegen<br />
hinaus. Juristen und Naturwissenschaftler<br />
sind meistens noch<br />
fünf Jahre nach Studienende kin-<br />
derlos. Die männlichen Mediziner<br />
sind am schnellsten: Sie bekommen<br />
häufiger und früher als<br />
alle anderen Absolventen Kinder.<br />
Vermutlich leben sie häufiger als<br />
andere in traditionellen Beziehungen,<br />
in denen die Partnerinnen<br />
sich ums Kind kümmern.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sind die Männer allgemein im Vorteil?<br />
Brandt: Für Männer lassen sich keine beruflichen<br />
Nachteile erkennen, wenn sie Vater werden. Bei<br />
den Frauen hingegen gehen Kinder und Karriere<br />
selten miteinander einher.<br />
Gesche Brandt ist<br />
wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin beim HIS-<br />
Institut für Hochschulforschung<br />
und beschäftigt<br />
sich mit Absolventen<br />
<strong>ZEIT</strong>: Hängt der berufliche Erfolg der Frauen<br />
also auch davon ab, ob sie Kinder bekommen<br />
oder nicht?<br />
Brandt: Absolventinnen mit Kindern sind auf<br />
jeden Fall seltener in leitenden<br />
beruflichen Positionen und haben<br />
geringere Durchschnittseinkommen<br />
als Väter oder auch als<br />
kinderlose Absolventinnen. Das<br />
hängt auch damit zusammen,<br />
dass Mütter häufig in Teilzeit beschäftigt<br />
sind. Nur vier Prozent<br />
der von uns befragten Männer<br />
mit Kindern arbeiten in Teilzeit.<br />
Bei den Müttern sind es 61 Prozent.<br />
Wenn Frauen die Karriere<br />
wichtig ist, bekommen sie unserer<br />
Studie zufolge seltener Kinder<br />
als Frauen, denen Familie wichtig<br />
ist. Das liegt wahrscheinlich daran,<br />
dass sie das Kinderkriegen aufschieben wollen<br />
bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich beruflich<br />
etabliert haben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Laut Ihrer Studie steigt aber auch etwa ein<br />
Viertel der Mütter nur kurz aus dem Beruf aus<br />
das Votum umschifft. Ihre Dozenten hat die ehemalige<br />
Freie Hochschule Mannheim an die<br />
ebenfalls anthroposophische Alanus-Hochschule<br />
in Nordrhein-Westfalen angedockt; sie geben<br />
per Franchisevertrag Unterricht für die Mannheimer<br />
Studenten und bereiten sie auf die Prüfungen<br />
der Alanus-Hochschule vor. Da die Alanus-Hochschule<br />
in Nordrhein-Westfalen anerkannt<br />
ist, ist dieses Vorgehen in Baden-Württemberg<br />
rechtens. Ähnlich wird sich wohl auch<br />
die Traunsteiner Hochschule für Homöopathie<br />
durch den bildungsföderalen Wirrwarr schlagen.<br />
Ein Weiterbildungsinstitut für Heilpraktiker<br />
dürfte sich nämlich nicht ohne Weiteres als<br />
Hochschule bezeichnen.<br />
Eine Hochschule nimmt<br />
die nächste Huckepack<br />
Gerade in Bayern sind die formalen Hürden für<br />
eine Gründung hoch: Das Land verlangt unter<br />
anderem, dass für die Lehre überwiegend hauptberufliche<br />
Fachkräfte eingesetzt werden, die Zugangsvoraussetzungen<br />
müssen die gleichen sein<br />
wie an einer öffentlichen Hochschule, und es<br />
müssen mehrere Studiengänge angeboten werden.<br />
Es sei denn, eine Hochschule, die sich andernorts<br />
etablieren konnte, nimmt die neue<br />
Einrichtung huckepack: Ein solcher Partner soll<br />
in Traunstein die homöopathiefreundliche Steinbeis-Hochschule<br />
aus Berlin werden. Ist eine<br />
Hochschule bereits in einem anderen Bundesland<br />
anerkannt, kann sie auch in Bayern Lehrangebote<br />
machen – ohne dass noch einmal neu<br />
geprüft werden muss, ob ihre Vorlesungen und<br />
Seminare tatsächlich wissenschaftlichen Ansprüchen<br />
genügen.<br />
Auf diese Weise bietet beispielsweise schon jetzt<br />
die Berliner Hochschule für Gesundheit und Sport<br />
in Ismaning den Studiengang Komplementärmedizin<br />
an. »Wenn eine Hochschule bereits in einem<br />
anderen Bundesland oder EU-Staat anerkannt ist<br />
und hier einen Standort aufmacht, können wir das<br />
nicht einfach untersagen«, erklärt eine Sprecherin<br />
des Wissenschaftsministeriums. »Selbst wenn es uns<br />
nicht gefällt.«<br />
und ist danach wieder in Vollzeit tätig. Was können<br />
die Gründe dafür sein?<br />
Brandt: Bei diesen Frauen hat die Berufstätigkeit<br />
einen hohen Stellenwert. Für sie kommen Teilzeitstellen<br />
weniger infrage. Außerdem ist ein Teil dieser<br />
Frauen selbstständig, wodurch sie Kinder und<br />
Beruf zeitlich besser vereinbaren können. Und<br />
diese Frauen beziehen häufig auch ihren Partner<br />
stärker in die Kinderbetreuung ein – wenngleich<br />
auch in diesen Fällen die Männer nur selten die<br />
Hauptverantwortung für die Kinder tragen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Können Sie aus Ihrer Studie ablesen, wann<br />
der beste Zeitpunkt fürs Kinderkriegen ist, um<br />
den beruflichen Wiedereinstieg zu schaffen?<br />
Brandt: Das ist sehr individuell und hängt auch<br />
davon ab, inwieweit der Partner sich in die Betreuung<br />
einbringen kann oder möchte. Aber sicherlich<br />
ist es hilfreich, nach dem Studium erst<br />
einmal eine Weile berufstätig zu sein. Für den<br />
Wiedereinstieg ist es von Vorteil, wenn die Frau<br />
sich vor der Familiengründung beruflich etabliert<br />
hat, um so gesichert wieder einsteigen zu<br />
können.<br />
Interview: ANIKA KRELLER<br />
Fotos: Peter Dazeley/Getty Images (o:); D. Ausserhofer (r.); privat (2)<br />
»<br />
»<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 71<br />
STUDENTEN ERKLÄREN IHRE WELT<br />
Hast du Ideen, wie sich Professorinnen<br />
und Professoren mit ihrem Expertenwissen<br />
mehr Gehör in der Politik<br />
verschaffen können?«<br />
… fragt:<br />
Jörg Hacker, Präsident<br />
der Leopoldina<br />
Zumindest nicht so, wie es zuletzt einige Experten<br />
anlässlich der Euro-Krise getan haben: Ihr<br />
offener Brief kam schlicht zu spät. Ich frage mich<br />
aber generell, ob Professoren überhaupt realitätsnahe<br />
Ratschläge geben können. Schließlich hängt<br />
ihre Karriere heute vor allem von der Zahl möglichst<br />
komplizierter Veröffentlichungen in Fachzeitschriften<br />
mit entsprechend begrenzter Leserschaft<br />
ab. Vielleicht wäre deshalb ein Vermittler<br />
zwischen Professoren, Politikern und Bürgern eine<br />
Lösung – ein Botschafter zwischen abstrakter Wissenschaftswelt<br />
und schnelllebigem Politikalltag.<br />
Kein einfacher Pressesprecher also, sondern vielmehr<br />
ein neutraler Ombudsmann als Übersetzer<br />
und Vermittler. Er müsste dafür sorgen, dass wichtige<br />
Forschungsergebnisse verständlich erklärt und<br />
publik gemacht würden. Mithilfe solcher Ansprechpartner<br />
würde Expertenwissen eher da landen,<br />
wo es hingehört: in der Realität.«<br />
… antwortet:<br />
Henrike Junge, 22 Jahre,<br />
die an der Uni Tübingen<br />
Internationale VWL studiert<br />
NACKTE ZAHLEN<br />
13<br />
... Prozent der befragten Westdeutschen zwischen<br />
16 und 24 wollen zum Studium nach Ostdeutschland<br />
ziehen. Das ergab eine Umfrage<br />
der Hochschulinitiative Neue Bundesländer.<br />
TIPPS UND TERMINE<br />
»Master Materialchemie«<br />
An der Universität des Saarlandes gibt es<br />
vom Wintersemester an den viersemestrigen<br />
Masterstudiengang Materialchemie. Er<br />
richtet sich an Absolventen der Fächer Chemie<br />
und Materialwissenschaften. Die Materialwissenschaftler<br />
erlernen die Grundoperationen<br />
der chemischen Synthese, während<br />
Chemiker die Betrachtung von Materialien<br />
und deren Eigenschaften aus einem werkstoffwissenschaftlichen<br />
Blickwinkel kennenlernen.<br />
Bewerbung bis zum 31. August.<br />
www.uni-saarland.de/materialchemie<br />
Deutscher Schulpreis<br />
Die Bosch-Stiftung zeichnet Schulen aus,<br />
die Kreativität und Lust an Leistung fördern,<br />
Lebensfreude und Lebensmut stärken<br />
und zu Fairness und Verantwortung erziehen.<br />
Bis zum 15. Oktober können sich alle<br />
deutschen Schulen bewerben – berufliche<br />
Schulen dann, wenn sie allgemeinbildende<br />
Abschlüsse vergeben und als Vollzeitschule<br />
organisiert sind. Der Hauptpreis beträgt<br />
100 000 Euro. Fünf weitere Preise von je<br />
25 000 Euro werden vergeben, alle anderen<br />
nominierten Schulen erhalten 2000 Euro.<br />
http://schulpreis.bosch-stiftung.de<br />
Berichtigung<br />
Auf Seite 79 der <strong>ZEIT</strong> Nr. 37 im Artikel Mission:<br />
Europa ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Im<br />
dritten Absatz muss es heißen: »250 Interviewmitschnitte«,<br />
und nicht 25. Wir bitten um Entschuldigung.



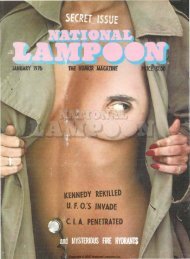

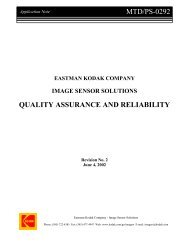
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

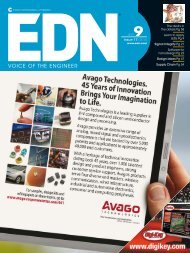

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)