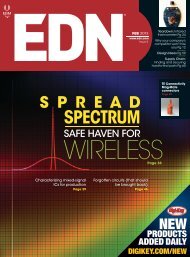DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FEUILLETON<br />
Geburt des Theaters<br />
Vor dem Theater, morgens. Natürlich<br />
trifft man gleich welche, die schon<br />
wissen, dass es idiotisch ist. Drei<br />
Opern an einem Tag, alle drei, die von<br />
»Il divino Claudio« überliefert sind,<br />
das ist doch bloß Event und Rekordversuch, die<br />
werden sich gegenseitig erschlagen. Manche haben<br />
sich den Verdacht zurechtgelegt, dass eine Neuinstrumentierung,<br />
die auch arabische Einsaiter und<br />
einen Synthesizer umfasst, nur weltmusikalisches<br />
Gaga sein kann, Populismus! Fürs Erste versprechen<br />
sie sich Kontaktpflege von diesem Tag an Berlins<br />
Komischer Oper. So viele Intendanten, Dramaturgen,<br />
Dirigenten sind angereist, dass ein Hauch Betriebsausflug<br />
in der Spätsommerluft liegt.<br />
Aber auch ein Hauch Huldigung. Ohne ihn, ohne<br />
Claudio Monteverdi, gäbe es das Genre gar nicht.<br />
Vielleicht erhofft man sich da den Zuspruch des<br />
großen, alten Bruders in einer anstrengenden Zeit,<br />
er hatte es ja auch nicht leicht. Alle sind erschöpft, es<br />
schläft keiner mehr ausreichend, alle haben Sorgen,<br />
erst recht die großen, rumpelnden Opernhausmaschinen.<br />
Dauernd werden sie auf einen ominösen Prüfstand<br />
geschoben, der, von wem, weiß keiner, so<br />
eingestellt ist, dass der Pfeil immer auf »zu teuer«<br />
zeigt. Das hat Konsequenzen, das schlaucht. Manche<br />
halten sich aufrecht mit der Gewissheit, dass schon<br />
seit gut 400 Jahren Opern gespielt werden.<br />
Im Theater, vormittags, Orpheus. Ein tiefes<br />
schwankendes D vom Kontrabass. Flirrende Orientalistik<br />
von einer Djoze, einem einsaitigen Streichinstrument<br />
aus dem Irak. Etwas Cimbalom. Frühe<br />
Regungen, die Oper ist noch gar nicht erfunden, nur<br />
Amor gibt es längst, einen alterslosen Mann im rosa<br />
Röckchen, der sich an einem Teich zu schaffen macht.<br />
Der Tod ist auch schon da, ein Mann in Schwarz<br />
lenkt die zarten Bewegungen einer skelettartigen<br />
Puppe. Dann aber platzt die Toccata aus dem Graben,<br />
und überall im Raum, in den Rängen, im wuchernden<br />
Garten, sind plötzlich Nymphen und Faune und<br />
lassen an langen Stangen Vögel flattern. Nymphen<br />
und Faune! Wo sind wir denn hier? In einem deut-<br />
schen Opernhaus des frühen 21. Jahrhunderts? Egal,<br />
es ist das pure Glück. Wäre der Jubel der Musik nicht<br />
so stark, man könnte hören, wie den Kritikern die<br />
Skalpelle und Messgeräte vom Schoß fallen. Es ist ein<br />
Ausbruch von so traumhafter, bunter Vitalität, dass<br />
einem der Grauschleier von Augen und Ohren gerissen<br />
wird und man nichts Geringeres erlebt als die<br />
Geburt des Theaters. Regisseur Barrie Kosky, der hier<br />
als Regisseur zugleich seine Intendanz eröffnet, ist<br />
offensichtlich kein bisschen erschöpft – und auch<br />
nicht naiv. In der überwältigenden Direktheit seines<br />
arkadischen Urknalls stecken alle Erfahrungen des<br />
Regietheaters, Ironie, Überspitzung, Brechung.<br />
Er hatte aber einfach mal Lust, neu anzufangen<br />
auf dieser Basis. Im wuchernden Garten, den Katrin<br />
Lea Tag geschaffen hat, gedeihen surreal große<br />
Früchte, während der Teich eindeutig ein Plastikpool<br />
ist. Das Timing, in dem die Fabelmenschen<br />
ausschwärmen, ist genau auf die Partitur abgestimmt.<br />
Elena Kats-Chernin, die sie neu instrumentiert,<br />
teils neu komponiert hat, lässt sie auch<br />
nicht einfach deswegen so arabisch starten, weil<br />
ein bisschen Cross-over nie schaden kann. Die Renaissance,<br />
aus der Monteverdi wuchs, ist undenkbar<br />
ohne den Umweg antiker Stoffe über jene<br />
maurischen Gelehrten, die sie besser hüteten als<br />
die Christen. Was wiederum alles egal ist, wenn<br />
man sich von dieser Musik verstanden fühlt.<br />
Es entsteht jene Komik, unter der<br />
man die Tiefe ahnt<br />
Dass Monteverdis Linien und Harmonien für Freude<br />
und Trauer, Schmerz und Hoffnung über 400<br />
Jahre hinweg ihre Bindungskraft behalten haben, ist<br />
ein Wunder, das gerade hier deutlich wird, im durchtrieben<br />
schlichten Setting. Wenn Orpheus (man singt<br />
deutsch) vom Tod seiner Eurydike erfahren hat, spielt<br />
Amor versonnen und tröstlich mit Papierschiffchen<br />
im Bassin, es sind aber zugleich die Vehikel des Fährmanns<br />
Charon – eine von vielen unaufwendigen,<br />
beiläufigen, treffenden Chiffren. In diesem Bassin<br />
ertrinkt am Ende der Held, anstatt mit Apoll zum<br />
Himmel aufzusteigen. Die Freudengesänge der Hirten<br />
sind zum puren Rhythmus skelettiert, in einem<br />
Trommelgewitter kämpft der Sänger vergeblich gegen<br />
seinen Untergang.<br />
Theater, mittags, 33 Jahre später. So viel Zeit verging<br />
für Monteverdi zwischen L’Orfeo und Il ritorno<br />
d’Ulisse, uraufgeführt 1640 in Venedig, diesmal nicht<br />
für einen vermögenden Herrscher, sondern für bürgerliches<br />
Publikum und mit kleinerem Etat, also<br />
ohne Chor. Vom zeitlosen Arkadien zum historisch<br />
grundierten Mythos, vom Garten zur Kunstrasenschräge,<br />
um die herum nun das Orchester sitzt – acht<br />
Celli, viel Blech, zwei Flügel, zwei moderne Harfen,<br />
eine westafrikanische Stegharfe, eine arabische Laute.<br />
Diesmal hat der exzellente Dirigent André de<br />
Ridder Probleme mit der Koordination, es fehlt zunächst<br />
am metrischen Zugriff, und auf dem Kunstrasen<br />
geht es szenisch so reduziert zu, dass ein paar<br />
Erschöpfte im Publikum eine Siesta einlegen. Theater<br />
ist eben auch anstrengend.<br />
Gerade noch rechtzeitig reißt Kosky den kargen<br />
Gegenentwurf zum verlorenen Arkadien hoch zur<br />
Karikatur, gemeinsam mit Monteverdi, der neben<br />
dem Erfinder der Oper auch ihr erster Hochkomiker<br />
ist. Die Freier, die Penelope belagern und hier als<br />
halbseidene Knallchargen auf Klappstühlen lümmeln,<br />
wären aber ohne Wirkung, hätte man nicht<br />
zuvor erlebt, wie bitter das ungewisse Warten für<br />
Penelope und Odysseus war. Die zwanzig Jahre der<br />
Trennung stellt man sich gern vor mittelmeerischem<br />
Hintergrund vor. Von dem bleibt hier nur das Funkeln<br />
der Kaskaden an Flügeln und Harfen, wobei das,<br />
nicht fern von Poulenc, auch etwas Ironisches hat.<br />
Der Kunstrasen lässt eher an Ehepaare denken, die<br />
sich auf ihrem Stückchen Grün vorm Reihenhaus<br />
auch ungetrennt nie wirklich finden.<br />
Monteverdi schreibt jetzt differenzierte, realitätsnahe<br />
Rezitative, in den Zwischenspielen lässt noch<br />
Orpheus grüßen. Zugleich aber wird deren archaische<br />
Aura von Elena Kats-Chernin in Tango und Paso<br />
doble überführt, und wenn dazu die Freier posen,<br />
entsteht jene Komik, hinter der es eben nicht flach,<br />
sondern tief wird. Trotzdem bleibt das Ganze so<br />
skizzenhaft wie das von Monteverdi überlieferte<br />
Material. Weder der Komponist spannt den großen<br />
Bogen noch der Regisseur – wobei ironischerweise<br />
der große Bogen des Odysseus zentrales Requisit ist.<br />
Es bleibt ein Tastversuch, Theater in der Krise, auch<br />
im 17. Jahrhundert, eine Krise, die dort allerdings<br />
einen ungeheuren Sprung vorbereitet.<br />
Zu preisen ist Barrie Kosky, einer der<br />
musikalischsten Regisseure heutzutage<br />
Arkadische Szene aus<br />
Monteverdis »Orpheus«<br />
an der Komischen Oper<br />
Berlin<br />
Vorm Theater, abends. Irgendwie ist man sogar<br />
erleichtert, dass der Odysseus ein bisschen karg und<br />
nicht nur aufregend war. Wer den ganzen Tag in<br />
und vor einem Opernhaus zubringt, sieht es gern,<br />
wenn es auch gewisse Parallelen zum Alltag gibt,<br />
vorausgesetzt, dass die Kurve am Abend wieder<br />
steigt. Und das tut sie, gerade weil Claudio Monteverdi,<br />
mittlerweile 75 Jahre alt, nur zwei Jahre<br />
nach seinem Odysseus, endgültig in der gesellschaftlichen<br />
Gegenwart ankommt mit der Krönung<br />
der Poppea. Längst versunken das mythische<br />
Arkadien mit seinen zeitlosen Schmerzen, es gibt<br />
auch keine Helden mehr, keine lauteren Herrscher.<br />
Es gibt Intrigen, Machtwahn, Geilheit, nirgends<br />
einen Gott.<br />
Außer natürlich Amor, den überragenden Peter<br />
Renz, der aber nun, längst zynisch geworden, als Diva<br />
mit weißer Boa den Champagnerkelch aus dem<br />
Bassin füllt, das einst ein Teich in Arkadien war und<br />
nun eine Pfütze in einer Steinwüste ist. Und Amor<br />
unterstützt ausgerechnet die Verbindung der Bösesten.<br />
Nur, wie böse sind Nero und Poppea? Monteverdi<br />
liefert in Dialogen von einer treffsicheren Rasanz,<br />
neben der jedes deutsche Fernsehspiel eine<br />
Meditationsrunde ist, eine Kritik der Macht und der<br />
Feigheit, die umso tiefer sitzt, als er jedem Protagonisten<br />
differenziert begegnet. Dem finalen Herrscherpaar,<br />
das über die Leiche des Philosophen Seneca geht,<br />
schreibt er eines der schönsten aller Liebesduette.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 53<br />
Abenteuerreise in die Welt Claudio Monteverdis:<br />
In Berlin sind alle drei Opern des Komponisten an einem Tag<br />
zu sehen – ein aufregender Kraftakt VON VOLKER HAGEDORN<br />
Niemanden verurteilt er mit seiner Musik, alle<br />
sieht er genau an, mal spöttisch, mal einfühlend. Eine<br />
comédie humaine der Oper, von keinem eingeholt – es<br />
ist, als habe Monteverdi die Entwicklung der Gattung<br />
vom Urmythos bis zu dem Moment, in dem Menschen<br />
wie wir auf der Bühne die Augen aufschlagen,<br />
in seinem Schaffen vorweggenommen. Barrie Kosky<br />
ist nicht der Erste, der die Gegenwärtigkeit entdeckt,<br />
aber er kann im Zusammenhang der Trilogie zusätzlich<br />
den Prozess der Ernüchterung zeigen, in der<br />
die Sehnsucht dem Zynismus weicht. Er will außerdem<br />
zeigen, welche Grausamkeiten der Zynismus<br />
hervorbringt. Sein Nero, seine Poppea foltern, blenden,<br />
richten hin. Sie sind richtig böse.<br />
Damit aber bleibt Kosky weit hinter Monteverdi<br />
zurück und auch hinter dem aktuellen Stand der<br />
Opernregie. Wie man eine Vergewaltigung so inszeniert,<br />
dass die Musik stirbt, das hat an diesem Haus<br />
vor neun Jahren Calixto Bieto vorgeführt, das brauchen<br />
wir nicht mehr, und eigentlich ist Kosky selbst<br />
viel weiter – als einer der musikalischsten Regisseure.<br />
Es ist wunderbar, wenn die gewaltige Amme Arnalta<br />
in Gestalt einer Putzfrau ihre Kippe genau dann ins<br />
Gürteltäschchen ascht, wenn neben fünf Bratschen<br />
ein Synthi-Ornament aufflackert. Und wie dieselbe<br />
Amme – Thomas Michael Allen mit dem raren Register<br />
des Haute-Contre – ihr Wiegenlied für Poppea<br />
singt, für diese Innigkeit hat Kosky Sinn.<br />
Und was dann nachts bleibt, wenn seltsamerweise<br />
niemand mehr erschöpft ist, das sind doch<br />
weniger diese und jene Schwäche und die Frage, ob<br />
das Banjo in der Poppea nicht unter seinen Möglichkeiten<br />
eingesetzt wurde. Es ist Bewunderung für 32<br />
Solisten, viele überragend, für einen kreativen Kraftakt,<br />
der weit mehr als die Summe seiner Teile hervorbrachte,<br />
nämlich das Universum eines Künstlers,<br />
der so viel von uns weiß, der unsere Gefühle in einer<br />
ungeheuren Klarheit wachruft. Natürlich wird sich<br />
das wieder alles relativieren, und die Kritiker haben<br />
ihr Besteck längst wieder zur Hand genommen.<br />
Aber so geht das ja nun schon seit 400 Jahren.<br />
Manchmal fühlen die sich an wie ein Tag.<br />
Foto (Ausschnitt): drama-berlin.de



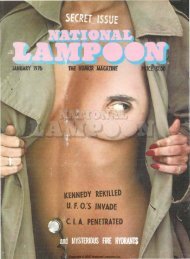

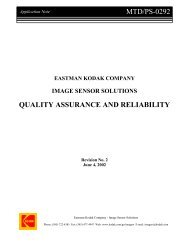
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

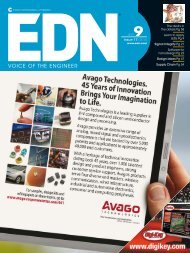

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)