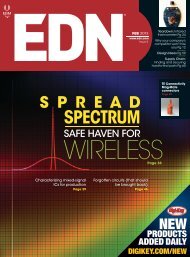DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WIRTSCHAFT<br />
Unter den Wüsten und Steppen der Mongolei lagern gewaltige Rohstoff vorkommen. Kann<br />
das Land davon profi tieren – oder wird sein Reichtum zum Fluch? VON ANGELA KÖCKRITZ<br />
Möglichkeiten geschaffen: Ihre Tochter macht gerade<br />
ein Praktikum in der Bank in Tsogtsesi.<br />
Und doch, sagen die Zogtgerels, hat die Entwicklung<br />
zwei Seiten. Die andere Seite, das sind<br />
die Zäune und die Mauern, die jetzt überall gebaut<br />
werden. »Früher«, sagt Zogtgerel, »konnten wir die<br />
Tiere hinführen, wo wir wollten. Jetzt können wir<br />
uns nicht mehr so frei bewegen.« Auch die Wasserknappheit<br />
macht Zogtgerel Sorgen. »Ich weiß<br />
nicht, ob es daran liegt, dass unser Brunnen schon<br />
so alt ist oder ob es mit dem Bergbau zu tun hat,<br />
doch in der letzten Zeit ist der Wasserspiegel stark<br />
gesunken.« Umweltschützer teilen seine Bedenken,<br />
sie kritisieren die Bergbauprojekte scharf, entstehen<br />
doch ausgerechnet die beiden größten des<br />
Landes im fragilen Ökosystem der Gobiwüste.<br />
Der Kohlehügel, sagt Zogtgerel, wehe an windigen<br />
Tagen Staub und Schmutz auf die Weiden, »für<br />
die Tiere ist das nicht gut«.<br />
Im Camp des Staatsunternehmens Erdenet<br />
wartet bereits sein Kollege, Campleiter R. Natsagdash.<br />
Er ist ein viel beschäftigter Mann, immer<br />
klingelt eines seiner beiden Handys, dann wieder<br />
kommen Parlamentarier zu Besuch, alle wollen<br />
wissen, wie es vorangeht. Er steht in seinem kleinen<br />
Containerbüro, gleich dahinter liegt die<br />
Waschküche, in der Erdenechimeg arbeitet, und<br />
tippt auf eine Karte, auf der unterschiedlich große<br />
Kringel zu sehen sind: die Vorkommen. 6,4 Milliarden<br />
Tonnen hochwertiger Kokskohle liegen hier.<br />
Noch beschäftigt das Projekt gerade mal 300 Mitarbeiter,<br />
2016 aber wird es das größte staatliche<br />
Bergbauunternehmen des Landes sein.<br />
Der Bauleiter ist kein Typ, der zu Überschwänglichkeit<br />
neigt, und doch malt er fantastische<br />
Visionen in den Gobisand. Die Kohle soll in<br />
einem ersten Verarbeitungsschritt gereinigt werden,<br />
ein Kraftwerk soll entstehen, ein Industriekomplex,<br />
zu viel wolle er da allerdings noch nicht<br />
verraten. Mitten in der Wüste soll eine neue Stadt<br />
gebaut werden, eine Erdenet-Stadt für Erdenet-<br />
Mitarbeiter, für 10 000 Menschen hat man geplant.<br />
Das mit dem Wasser, sagt der Campleiter,<br />
sei gar kein Problem, »wir haben da staatliche Gutachten«.<br />
Die Botschaft des Campleiters: Die Mine<br />
schafft Arbeitsplätze. Und nutzt außerdem jedem<br />
Mongolen. »Unabhängig vom Alter und Geschlecht<br />
soll jeder Mongole Anteile am Unternehmen<br />
erhalten. Wenn sie die nicht wollen, können<br />
sie sie verkaufen und Bargeld dafür bekommen.«<br />
Für Erdenechimeg und Zogtgerel steht fest: Sie<br />
werden die Aktien behalten. Ein bisschen haben<br />
sie sich schon an Geschenke des Staates gewöhnt.<br />
Vor der letzten Wahl hat man ihnen 500 000 Tugrig<br />
versprochen, etwa 300 Euro, 300 000 haben sie<br />
dann wirklich bekommen. »Wie wir das ausgegeben<br />
haben? Ach, keine Ahnung«, lacht Zogtgerel.<br />
»Irgendwie haben wir’s schon verbraten. Wahrscheinlich<br />
für das Studium der Töchter.« Im Prinzip<br />
aber findet er die Bargeldgeschenke nicht richtig.<br />
»Viel besser wäre es doch gewesen, der Staat<br />
hätte mit dem Geld Schulen und Straßen gebaut,<br />
das hätte allen etwas gebracht.« Zogtgerel glaubt,<br />
dass von dem Bergbauboom nur wenige profitieren<br />
werden. »Und wir gehören nicht dazu.«<br />
Das mit den Cash-Handouts, sagt Otgochuluu,<br />
der Mann von dem Thinktank, war einfach nur fatal.<br />
»Das ganze Hot Money macht die Politiker völlig<br />
kurzsichtig. Sie machten Wahlgeschenke, bei der<br />
letzten Wahl bekam jeder Mongole Bargeld, und was<br />
waren die Folgen? Die Inflation ging hoch, die Zentralbank<br />
erhöhte den Leitzins, der Privatsektor litt,<br />
und viele Jobs wurden vernichtet.« Ob die Mongolei<br />
es schaffen wird, ihren Reichtum gut zu verwalten,<br />
das liege an den Menschen, glaubt Otgochuluu. Und<br />
an politischen Institutionen.<br />
Einerseits scheinen diese, trotz Korruption, für<br />
eine junge Demokratie recht stabil zu sein – eine<br />
Ausnahme waren die Unruhen bei der Wahl von<br />
2008. Andererseits aber wirken sie bisweilen ähnlich<br />
zusammengewürfelt wie die Architektur Ulan-<br />
Bators. Beim Wahlrecht hat man sich sowohl von<br />
Deutschland als auch von Großbritannien inspirieren<br />
lassen, beim Budgetrecht von Neuseeland,<br />
»von jedem ein bisschen, und am Ende passt es<br />
nicht wirklich zusammen«, sagt Otgochuluu.<br />
Was die Mongolei außer Bodenschätzen<br />
noch zu bieten hat, ist schwer zu sagen<br />
Mit einem Mal geht die Tür auf und P. Tsagaan<br />
schreitet herein, der Berater des Präsidenten für<br />
Rohstoffpolitik. Kopfschüttelnd überreicht er seine<br />
Visitenkarte: »Da steht Senior Advisor drauf,<br />
dabei müsste es doch Chief Advisor heißen. Pff,<br />
meine Berater können alle kein Englisch.« Die<br />
Bargeldgeschenke ans Volk, sagt er, »waren ein<br />
wirklich schlechtes Beispiel. Das Parlament hat sie<br />
jetzt verboten«.<br />
Ein Staatsfonds, das sei die einzige Lösung,<br />
»Dutch Disease und den Fluch der Bodenschätze<br />
zu vermeiden«. Nur so könnten die Einnahmen<br />
aus den Bodenschätzen sinnvoll verwaltet werden.<br />
»Wir schauen uns das genau an, 60 Länder haben<br />
ganz unterschiedliche Lösungen gefunden.« Er<br />
persönlich liebäugele mit dem norwegischen Pensionsfonds,<br />
auch einige arabische Länder hätten<br />
gute Lösungen gefunden. Statt Bargeld zu verteilen,<br />
solle die Regierung lieber soziale Anreize setzen.<br />
»Kindergeld zum Beispiel.«<br />
Die eine Frage ist, wie man die Einnahmen aus<br />
den Bodenschätzen sinnvoll verwaltet. Die andere,<br />
was die Mongolei außer Bodenschätzen eigentlich<br />
zu bieten hat. Wenn das Land wirklich dem Fluch<br />
der Bodenschätze entkommen will: Welche Geschäftszweige<br />
könnte es dann noch entwickeln?<br />
Keine einfache Frage – bei diesen Nachbarn.<br />
Südgobi, Tavan Tolgoi. Mitten in der Wüste<br />
tut sich ein schwarzer Schlund auf, Bagger graben<br />
sich tief in die Kohlevorkommen hinein. Am<br />
Rand des Abgrunds steht Minenmanager B. Batsaikhan,<br />
ein bulliger Typ, Goldringe an dicken<br />
Fingern, die Sonnenbrille erinnert an Men in<br />
Black. Er ist kein Mann der großen Worte. Lieber<br />
raucht er genüsslich vor einem »Hier können Sie<br />
rauchen«-Schild, eher wirkt es wie ein »Hier können<br />
Sie nicht rauchen«-Schild, dem einer das<br />
»nicht« davongetragen hat, doch wer könnte das<br />
hier schon so genau sagen. Er nickt zu den Kohlelastern.<br />
»Kommt alles nach China. Bald werden<br />
wir die größten Exporteure des Landes sein.« Noch<br />
liefern sie unter Weltmarktpreis, eine Tonne für 70<br />
US-Dollar.<br />
Otgochuluu lächelt müde. »Der niedrige Preis,<br />
den wir für unsere Kohle bekommen, das hat ein<br />
wenig damit zu tun, dass die Kohle noch nicht veredelt<br />
ist. Viel mehr aber mit der Macht der Chinesen.<br />
China ist unser einziger Käufer. Es absorbiert<br />
92 Prozent unserer Exporte und versorgt uns mit<br />
der Hälfte an Importen, Öl nicht eingeschlossen.<br />
Das mongolische Wachstum hängt ganz am chinesischen.«<br />
Das zu akzeptieren ist für viele Mongolen<br />
nicht einfach, pflegen sie doch ihre antichinesischen<br />
Ressentiments mit Leidenschaft.<br />
»Keines der Viehzüchterkinder<br />
will mehr Viehzüchter sein«<br />
Sie sind ein Erbe des jahrtausendealten Konfliktes<br />
zwischen Nomaden und sesshaften Bauern, vor allem<br />
aber das Erbe einer Zeit, als die Qing-Dynastie die<br />
Mongolei beherrschte. Chinesische Männer, die mit<br />
mongolischen Frauen ausgehen, werden bisweilen<br />
verprügelt, chinesische Wanderarbeiter ebenso – was<br />
viele Mongolen achselzuckend quittieren. »So was<br />
passiert eben«, heißt es dann.<br />
Ganz im Gegensatz dazu steht das diplomatische<br />
Geschick und Feingefühl, das die Mongolei<br />
auf der internationalen Bühne aufbringen muss.<br />
Eingezwängt zwischen zwei Großmächten, Russland<br />
und China, hat jedes Detail das Potenzial,<br />
zur Staatsaffäre zu werden. So auch die Mine Tavan<br />
Tolgoi. Eigentlich sollte sie vom chinesischen<br />
Konzern Shenhua, Peabody sowie einer russischmongolischen<br />
Gruppe gemeinsam entwickelt<br />
werden. Dann aber protestierten Japaner und<br />
Südkoreaner, weil man sie nicht einbezogen hatte,<br />
und die mongolische Regierung blies das Projekt<br />
ab.<br />
Die Mongolei muss auf viele Staaten Rücksicht<br />
nehmen. Um die Übermacht Chinas und Russlands<br />
zu kontern, hat sie die Politik des Dritten<br />
Nachbarn entwickelt. Südkorea, Japan, die USA,<br />
Deutschland, auch Italien zählt die Mongolei zu<br />
diesem Kreis. Gerne würde man dem Einfluss<br />
Chinas auch durch ein Bündnis mit Indien begegnen,<br />
»doch die Inder sind leider nicht so aktiv«.<br />
Die strategische Lage beherrscht auch die<br />
Volkswirtschaft der Mongolei. Die berühmte Eisenbahnlinie<br />
etwa. Sie verläuft einspurig, gerne<br />
würde die Regierung sie ausbauen. Das aber führt<br />
zu allerlei Verwicklungen und Problemen mit dem<br />
russischen Staat, dem 50 Prozent der Linie gehören.<br />
Ähnlich verhält es sich mit den Exporten. Allzu<br />
gerne würde die Mongolei mehr Waren nach<br />
Europa exportieren, doch dazu müssten sie Russland<br />
passieren, »und die Transitgebühren sind<br />
sehr, sehr hoch«, sagt Otgochuluu.<br />
Ohnehin stellt sich die Frage: Was will die<br />
Mongolei eigentlich exportieren, wo China, der<br />
Nachbar im Süden, der Welt doch fast alles billiger<br />
und in besserer Qualität bieten kann? In sozialistischen<br />
Zeiten war die mongolische Industrie entwickelter<br />
als heute. Damals waren etwa 30 Prozent<br />
der Fleischexporte verarbeitet, heute ist es nur<br />
noch ein verschwindend geringer Teil. Aus der<br />
Mongolei stammt zwar ein Drittel der weltweiten<br />
Kaschmirproduktion, das meiste aber wird als<br />
Rohstoff in andere Länder geliefert. Nur wenige<br />
Firmen wie zum Beispiel Gobi schneidern daraus<br />
auch Kleider.<br />
Was Otgochuluu nicht davon abhält, von einer<br />
Zukunft zu träumen, in der die Mongolei Ökofleisch<br />
und feine Kaschmirkleidung in die ganze<br />
Welt verkauft und Ökotourismus in der Steppe<br />
anbietet. »Wir können uns nicht mit China messen.<br />
Wir müssen etwas ganz anderes machen.« Mit<br />
Kaschmirpullis und Reiterferien kann man zwar<br />
nicht Millionen Jobs schaffen. Andererseits gibt es<br />
auch nur 3,18 Millionen Mongolen.<br />
Südgobi, die Jurte der Zogtgerels. Die Nacht<br />
senkt sich über der Steppe. Tochter Sumya geht<br />
die Kamele melken. Sie kann es noch immer wie<br />
im Schlaf, obwohl sie doch längst in Ulan-Bator<br />
Elektrotechnik studiert. Auch sie möchte mal bei<br />
Erdenet arbeiten, am liebsten im Kraftwerk, »so<br />
kann ich nahe bei meiner Familie sein«. Der Bergbauboom<br />
habe sein Gutes, sagt sie, und doch frage<br />
sie sich, »ob noch genug bleibt für die Generationen,<br />
die nach uns kommen«.<br />
Wie diese wohl mal leben werden? Sumya<br />
selbst will keine Viehzüchterin mehr sein, ihren<br />
Freunden und Kollegen geht das genauso. »Und<br />
trotzdem kann ich mir gar keine Mongolei ohne<br />
Nomaden vorstellen. Das macht uns doch aus.«<br />
Zogtgerel hört zu und nickt. »Ich sehe es um<br />
uns herum, keines der Viehzüchterkinder will<br />
mehr Viehzüchter sein. Wir«, sagt er und nickt in<br />
Richtung seiner Frau, »werden bei den Tieren bleiben,<br />
bis wir sterben.« Er schweigt und greift zur<br />
Wodkaflasche, einen kurzen Moment denkt er<br />
nach, will den traurigen Satz wohl nicht so stehen<br />
lassen. Er nimmt einen tiefen Schluck und lacht.<br />
Draußen seufzen die Kamele.<br />
Lastwagen fahren zur Kokskohlemine Tavan Tolgoi im Süden der Gobiwüste<br />
Ein Mädchen springt Seil vor den Toren Ulan Bators<br />
Lastwagen stehen vor dem Bergwerk von Tavan Tolgoi<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 27<br />
Fotos: Kieran Doherty/Corbis (2); Gilles Sabrie/NYT/Redux/laif (mitte); Angela Köckritz für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> (klein, S. 26)



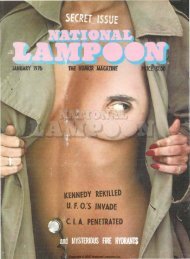

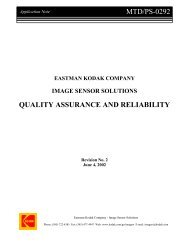
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

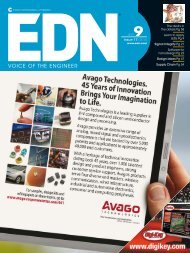

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)