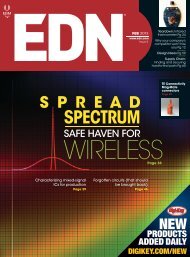DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FEUILLETON<br />
LITERATUR<br />
Keiner wäscht reiner<br />
Ulf Erdmann Zieglers Roman erkundet die weißen Geheimnisse der deutschen Vergangenheit VON HUBERT WINKELS<br />
W<br />
»heilige« Johanna, zur Erstkommunion gehen.<br />
Lore trennt sich von ihrem Petrus und bleibt<br />
mit dem Geistlichen Valentin zusammen.<br />
Kennengelernt haben sich Lore und der<br />
Kaplan, weil Marleen dem Kommunionunterricht<br />
fernblieb. Sie sah keine Chance, »Mini«<br />
zu werden, also Ministrantin, eben wegen der<br />
»Unreinheit« der Mädchen. Dafür wurden<br />
Marleen und ihre Schwestern dann die ersten<br />
Testerinnen der neuen o.b.-Tampons, bevor<br />
eben auf dem Hintergrund von etwas. Dies<br />
eben meint der Titel: Es gibt nichts Weißes,<br />
ohne dass es sich von einer farbigen Umgebung<br />
abheben würde, sei es einer Linie, einem<br />
Fond, einem Schatten. Die bildende Kunst<br />
hat sich im 20. Jahrhundert mit Malewitsch<br />
und den amerikanischen Farbfeldmalern in<br />
diese Richtung weit vorgearbeitet, mit dem<br />
Weißen und dem Schwarzen Quadrat als quasimetaphysischen<br />
Schlüsselpositionen. Das<br />
Papa damit die große Werbe- und Aufklärungs- Motiv des »Reinweißen« bildet auch einen<br />
Ulf Erdmann<br />
Ziegler:<br />
Nichts Weißes<br />
Roman;<br />
Suhrkamp<br />
Verlag, Berlin<br />
259 S., 16,99 €<br />
äre der Tampon, wäre o.b.<br />
schon erfunden gewesen,<br />
hätten Mädchen dann<br />
schon früher in der katholischen<br />
Messe den Ministrantendienst<br />
versehen dürfen,<br />
gäbe es gar weibliche Geistliche,<br />
Zelebrantinnen der Verwandlung<br />
von Wein in Blut?<br />
Dürften sie o.b.-bewehrt das<br />
Blut opfer feiern, weil sie selbst<br />
nicht mehr bluteten, jedenfalls nicht sicht-<br />
und riechbar?<br />
Das ist eine der großen Fragen, die Ulf<br />
Erdmann Zieglers Roman aufwirft. o.b. und<br />
Eucharistie, Menstruationsblut und Blut der<br />
Wandlung, Kommunionkinder und Charles<br />
Wilps Afri-Cola-Nonnen hinter beschlagenen<br />
Glasscheiben, Sex im Aschram und der<br />
heilige Yogi, Letraset-Buchstaben und die<br />
Heilige Schrift, Katechismus und Werbetexte<br />
im Düsseldorf der siebziger, achtziger Jahre:<br />
Das sind Kon fron ta tio nen, mit denen<br />
Ziegler spielt. Dabei geht es ihm durchaus<br />
um den inneren Zusammenhang zwischen<br />
der modernen Gesellschaft und den spirituellen<br />
Sinnwelten.<br />
Ein Architekt, ein Designer, ein Typograf<br />
organisieren Räume und Zeichen, die Bedeutung<br />
tragen, ohne dass man sie bemerken<br />
muss. Das war schon in Zieglers erstem Roman<br />
Hamburger Hochbahn ein Thema. Im<br />
neuen Roman geht es um Schrifttypen und<br />
Typografie und ihre Anwendung in der<br />
Werbe indus trie. Die puristische Moderne<br />
und die Überlieferung des Abendlandes sind<br />
das Spannungsfeld des Buches. Und es ist<br />
von Anfang an klar, dass dieses Verhältnis<br />
sich in Übergängen, Spiegelungen, Konversionen,<br />
Übersetzungen und geheimen Identitäten<br />
ausdrückt, nicht in Gegensätzen und<br />
Ausschlüssen.<br />
Ebenso klar ist, dass Nichts Weißes dem<br />
rätselhaften Titel zum Trotz kein intellektueller<br />
Essay ist, sondern ein Roman mit richtigen<br />
Figuren und vielen Geschichten, die von<br />
der Beinahe-Gegenwart bis in die unmittelbare<br />
Nachkriegszeit und manchmal darüber<br />
hinaus zurückreichen: ein Familien-, Gesellschafts-,<br />
Entwicklungsroman, wie geschaffen<br />
für den Deutschen Buchpreis, auf dessen<br />
Shortlist er inzwischen steht. Zeitgeschichte<br />
spiegelt sich in Familien- und individuellen<br />
Schicksalsgeschichten.<br />
Und das sieht in etwa so aus: Marleen, zentrale<br />
Figur des Romans, ist die Tochter eines<br />
erfolgreichen Werbers und einer Gebrauchsgrafik<br />
produzierenden Mutter. Die fünfköpfige<br />
Familie zieht von Düsseldorf in einen modernistischen<br />
Vorort von Neuss namens Pomona,<br />
im späten Bauhausverhunzungsstil gebaut, und<br />
ist dort durchaus nicht glücklich. Was unter<br />
anderem mit den weltlich-geistlichen Konversionen<br />
zu tun hat, die fast alle Familienmitglieder<br />
erfassen: Der flotte Vater namens Petrus,<br />
der ebenjene »Ohne Binde«-Hygienekampagne<br />
gestartet hat und damit die Frauenrolle, das<br />
Freiheitsgefühl, die intime Verfassung der Republik<br />
verändert hat, dieser Petrus wird von<br />
einem Sinnhunger befallen, der ihn vom ruhelosen<br />
Dasein als Jet set-Geschäftsmann zwischen<br />
New York, Hongkong und Delhi nach Poona<br />
führt, wo er Anhänger des heiligen Rolls-<br />
Royce-Fahrers Shree Rajneesh wird, sprich ein<br />
Sannyasi. Mutter Lore verguckt sich ihrerseits<br />
in einen katholischen Kaplan der Kirchengemeinde,<br />
in der die Töchter, namentlich die<br />
Die ersten Tampons haben nicht nur die innere<br />
Verfassung der Republik verändert.<br />
Sie warfen auch schwerwiegende religiöse Fragen auf<br />
kampagne aufzog. Der sexuell-säkularisationsgeschichtliche<br />
Untergrund des Romans wird<br />
bald überdeutlich. Marleens erste große Liebe<br />
Franziskus verlässt sie, nachdem er ihr ein Kind<br />
gemacht hat, um in einen katholischen Orden<br />
einzutreten. Johanna liegt weinend vor dem<br />
Bild des nackten zwölfjährigen o.b. bewerbenden<br />
Illustrierten-Mädchens, den Katechismus<br />
neben sich, aus dem der tröstende Papa Petrus<br />
ihr vorliest. Am selben Abend liegen die Eheleute<br />
im Bett und überlegen, ob Johanna wohl<br />
eifersüchtig sei, auf die o.b.-Kampagne, auf<br />
Papa Petrus, auf den Papst, und dabei lässt Lore<br />
»ihre Hand in seine seidene Pyjamahose gleiten«<br />
und flüstert: »Ihr werdet ein Fleisch sein.«<br />
Untergrund, Hintergrund, Figur<br />
und Grund: Nach diesem Muster<br />
entwickelt sich noch ein<br />
anderes, eher erkenntnistheoretisches<br />
Problem im Roman, eigentlich<br />
das reizvollere, das sich daraus ergibt,<br />
dass wir etwas immer nur in Abgrenzung zu<br />
etwas anderem wahrnehmen können oder<br />
schönen bildlichen Anschluss an die Kinderkommunion,<br />
die Unbeflecktheit Mariens,<br />
die o.b.-Trägerinnen, die weißen Pomonavillen<br />
und was da sonst alles weiß durch den<br />
Roman gespenstert.<br />
Seltsamerweise hat sich Ziegler in seinem<br />
Neuss-Düsseldorf-Buch den Weißheitsfuror<br />
der Persil-Werbung des dortigen Henkel-Konzerns<br />
entgehen lassen, der metaphorisch überdeutlich<br />
den Sauberkeits- und Weißheitswahn<br />
der deutschen Nachkriegsgesellschaft verkörpert<br />
– alles wurde blütenweiß gewaschen und<br />
von der historischen Schuld des Nationalsozialismus<br />
von Grund auf gereinigt. Nur in einem<br />
Interview von Petrus kommt das vor, wenn er,<br />
selbst Werbeguru geworden, einer Illustrierten<br />
erläutert, dass er die Nazibeschriftung durch<br />
die Napola, der er als Kind ausgesetzt war,<br />
überwinden musste.<br />
Man muss an dieser Stelle auf einen zu<br />
Unrecht halb vergessenen Roman von Dieter<br />
Forte, Auf der anderen Seite der Welt, hinweisen,<br />
der von der Düsseldorfer Werbeszene ab den<br />
fünfziger Jahren handelt, im starken Zusam-<br />
menhang mit der Kunstakademie und dem<br />
Henkel-Konzern. Die Geschichte der Bundesrepublik<br />
und ihrer zunehmenden Einbindung<br />
in die westliche Konsumwelt über Werbung,<br />
Grafik und Kampagnen zu erzählen wäre überhaupt<br />
von höchstem Reiz.<br />
Ulf Erdmann Zieglers Roman leistet durchaus<br />
einen gewissen Beitrag dazu, obwohl er<br />
mehr an der Metaphysik des Buchstabens und<br />
anderen intellektuellen Kostbarkeiten interessiert<br />
ist. Die gute Romankonstruktion leidet<br />
unter dieser Fracht. Jede Episode, jede Bemerkung<br />
wird im Zieglerschen Idealfall dreimal<br />
codiert. Alles spielt auf vielen Ebenen gleichzeitig.<br />
Der Roman ist von einem überfordernden,<br />
leicht snobistischen Ästhetizismus geprägt.<br />
Man sieht die Mittel, erkennt die Technik,<br />
bewundert des Autors Fingerfertigkeit, doch<br />
ebendies, das Demonstrative, die modernistische<br />
Angeberei, ärgert ein wenig.<br />
Diese Sichtbarkeit des Könnens<br />
steht in Spannung zur Arbeit<br />
Marleens. Sie möchte eine<br />
Schrift entwickeln, die »alle<br />
Vorzüge aller existierenden<br />
Schriften hat und alle Nachteile Buchstabe<br />
für Buchstabe überwindet«. Herauskommen<br />
soll dabei eine Schrift, »die man gar nicht<br />
bemerkt«. Diese Idee von einem beinahe<br />
unsichtbaren, aber dennoch bedeutungstragenden<br />
Zeichen zieht sich durch das gesamte<br />
Buch – und ist zugleich eine euphorisierende<br />
Chiffre in der modernen Kunst. Marleen<br />
trifft auf ihrer Suche nach dieser geheimnisvollen<br />
Schrift einen Schweizer<br />
Schriftentwickler in Paris, der eine solche<br />
Schrift type schon erfunden hat. Nicht zufällig<br />
heißt sie Tempi Novi. Ihr Erfinder<br />
wird mit dieser eigenschaftslosen modernen<br />
Schrift zum »Gott der Gottlosigkeit« und<br />
Marleen eine »Ketzerin, die nun gezwungen<br />
wäre anzuerkennen, dass den Kult der Gottlosigkeit<br />
zu begründen nicht mehr möglich<br />
wäre«. Unter dieser Großmetaphorik tut es<br />
der Roman an keiner Stelle.<br />
Trotzdem kommt er gut in der Welt herum.<br />
Zur Ausbildung Marleens geht es nach Nördlingen<br />
in eine Druckerei, die der Anderen Bibliothek<br />
von Franz Greno zum Verwechseln ähnelt,<br />
dann nach Kassel zum Studium, nach Paris in<br />
eine Agentur und schließlich in die USA, wo<br />
nach der Blei- und der Lichtsatz-Phase jetzt die<br />
digitalen Schriften entwickelt werden. In den<br />
späten Achtzigern, als Marleen bei IOM arbeitet,<br />
einem IBM nachempfundenen Unternehmen,<br />
endet der Roman, der mit ihrem Weg<br />
in die USA begonnen hat. Unterwegs haben wir<br />
viel gelernt über die Lebendigkeit der Schrift,<br />
die ja eine paulinische ist, eine lutherische und<br />
eine typografische.<br />
Die Eigenschaftslosigkeit ist dabei ein Ideal,<br />
das Ziegler nicht nur beschwört, sondern auch<br />
inszeniert. Was seine Romanheldin Marleen<br />
angeht, gelingt ihm das vorzüglich. Für den<br />
Roman selbst gilt das allerdings nicht. Er ist in<br />
seiner Form und mit seinen Zeitsprüngen als<br />
Kunstwerk jederzeit gut sichtbar. Er lenkt die<br />
Leseaufmerksamkeit hochgradig auf sein Gemacht-,<br />
sein Gekonntsein. Ein Jota zu viel für<br />
ein ästhetisches Programm der Weißwäsche, der<br />
Dezenz, der Diskretion und des Sich-unsichtbar-Machens.<br />
Als hygienisches Vorzeigestück<br />
blutet und riecht das Buch zwar nicht, doch dass<br />
es voll von Bedeutung und sinnschwanger wie<br />
die trächtige Muttergottes ist, das will es uns<br />
allzu deutlich sagen.<br />
Fotos [M]: Johnson & Johnson (l.); www.launer.com<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 47<br />
GEDICHT: RICHARD BRAUTIGAN<br />
(1935–1984)<br />
Liebesgedicht<br />
Es ist so schön,<br />
morgens ganz allein<br />
aufzuwachen<br />
und keinem sagen zu müssen,<br />
dass man ihn liebt,<br />
wenn man ihn nicht mehr<br />
liebt.<br />
Richard Brautigan: Ausgewählte Texte<br />
Aus dem Englischen von Günter Ohnemus u. a.;<br />
Hoffmann und Campe, Hamburg <strong>2012</strong>;<br />
128 S., 12,– €<br />
WIR RATEN ZU UND AB<br />
Buch zur Tasche<br />
Von allen Gegenständen, die mit Kin deraugen<br />
beschaut werden, ist die Handtasche<br />
der märchenhafteste. Klein und handlich<br />
schwankt sie am Arm der Mutter, und es<br />
entspringen ihr im Laufe eines nachmittäglichen<br />
Spaziergangs eine Flut an Gerätschaften,<br />
die unmöglich allesamt in ihr Platz finden<br />
können: Taschentücher und ein Notizblock,<br />
ein Lippenstift und die dicke Geldbörse,<br />
Fisherman’s Friend und Obst, heute<br />
vermutlich auch ein Smart phone samt Kabelsalat.<br />
Ein Durch ein an der muss in so einer<br />
Handtasche ja herrschen, doch findet<br />
die Hand sofort immer das, was sie sucht.<br />
Es ahnt schon der heranwachsende Junge,<br />
dass darin auch Diskretes Platz findet. Aber<br />
niemals würde er die Tasche heimlich öffnen.<br />
Er ahnt, dass ihn nichts stärker an die<br />
Mutter bindet als das Ungezeigte. Und<br />
nichts fürchtet er natürlich mehr als das Erwachsenwerden.<br />
Jetzt, endlich, hat Jean-<br />
Claude Kaufmann das Buch zur Handtasche<br />
geschrieben. ADAM SOBOCZYNSKI<br />
Völlig unnötig<br />
Der Soziologe Jean-Claude Kaufmann hat<br />
ein Frauenbuch geschrieben. Über Handtaschen<br />
– rosa Cover mit roter Lacktasche aus<br />
den Neunzigern. Wer braucht das? Frauen<br />
wissen um ihr in der Tasche lebendes erweitertes<br />
Ich, sie müssen dazu nichts lesen – es<br />
sei denn, sie tragen rote Lacktaschen aus<br />
den Neunzigern, dann herrscht Nachholbedarf.<br />
Kaufmann gelingt es nicht, über Stereotype<br />
hinauszukommen. Dass Frauen mit<br />
Papier in der Tasche (zum Lesen oder<br />
Schreiben) eher intellektuell sind und Frauen<br />
mit vielen Kunden- und Kreditkarten<br />
eher shoppingsüchtig, hätte man vermuten<br />
können. Als es auf Seite 120 interessant zu<br />
werden droht, rät der Autor: »Die Leser,<br />
denen dies zu komplex ist, können problemlos<br />
die folgenden Seiten überspringen.«<br />
Ernsthaft? NIKOLA HELMREICH<br />
Jean-Cl. Kaufmann:<br />
Privatsache Handtasche<br />
UVK Verlagsgesellschaft <strong>2012</strong>; 198 S., 19,99 €



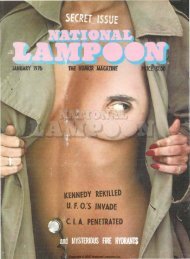

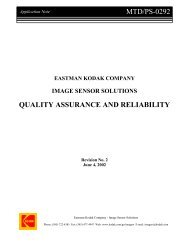
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

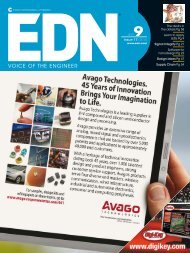

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)