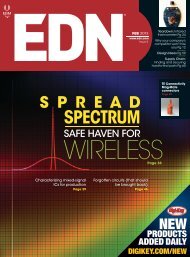DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KUNSTMARKT<br />
Auf dem aufgeräumten Tisch<br />
liegen iPad und iPhone. In<br />
schöner Regelmäßigkeit summen<br />
die Geräte und melden<br />
diskret den Eingang neuer E-<br />
Mails oder Anrufe. Wir sind in<br />
einer Galerie, in einer jungen<br />
noch dazu. Ihr Name: Kraupa-Tuskany. Der<br />
knapp 30-jährige Amadeo Kraupa-Tuskany betreibt<br />
sie gemeinsam mit seiner Partnerin Nadine<br />
Zeidler, einer Kunsthistorikerin. Seit 2011 zeigt<br />
das Duo meist junge, oftmals internetaffine<br />
Kunst von Künstlern wie AIDS-3D oder Florian<br />
Auer an einer selbst für Berliner Verhältnisse eher<br />
ungewöhnlichen Adresse. Kraupa-Tuskany residiert<br />
in einem ehemaligen Serverraum im vierten<br />
Stock eines alten Ostberliner Bürogebäudes direkt<br />
am Alexanderplatz. Wer den Aufzug nimmt<br />
und den nüchternen Bürogang hinuntergeht,<br />
erwartet hier alles, nur keinen Ausstellungsraum:<br />
Die Nachbarn sind Import-Export-Geschäfte<br />
und Vertreterbüros. »Es war uns wichtig, in ein<br />
Bürogebäude zu gehen«, erklärt Ziegler. »Das hat<br />
etwas Ehrliches.«<br />
Was treibt jemanden dazu, nach einem Boom-<br />
Jahrzehnt in den kriselnden Kunstmarkt einzusteigen?<br />
Was verkauft man da eigentlich und vor allem:<br />
wie? Nach Schätzungen gibt es etwa 400 Galerien<br />
in Berlin. Jedes Jahr schließen einige, dafür machen<br />
neue auf. Der Galerist ist der Zehnkämpfer des<br />
Kunstbetriebs: Er muss kalkulieren, verkaufen,<br />
spekulieren und dabei nicht nur die Kunstproduktion<br />
seiner Künstler, sondern auch die schwierigsten<br />
Sammler lange und geduldig begleiten. Den Besten<br />
gelingt es, ihre Künstler in strategisch wichtigen Ausstellungen<br />
zu platzieren und so möglichst geräusch-<br />
Intellektuell und sexy<br />
los für die Einordnung in kunsthistorische Zusammenhänge<br />
zu sorgen. Sprechen sie selbst über ihr<br />
Tun, dann klingt es ganz einfach. Er sehe sich als eine<br />
Art »Agent«, sagt Kraupa-Tuskany, als jemand, dem<br />
es darum gehe, »die Sachen an den Mann zu bringen,<br />
inhaltlich wie kommerziell«.<br />
Ist es diese Mischung aus intellektuellem Glamour<br />
und der Sexiness unternehmerischer Risikobereitschaft,<br />
die den Galeristen gegenwärtig zur<br />
heimlichen Leitfigur des Betriebs macht? Langsam,<br />
aber sicher hat das Galerist-Sein den freien Kurator<br />
als begehrten Trendjob der Kunstwelt abgelöst.<br />
Colin de Land ist heute cooler als Harald Szeemann.<br />
Der 2003 verstorbene Betreiber der New Yorker<br />
Galerie American Fine Arts ist das role model all jener,<br />
die in ihrem Tun mehr als Kunsthändler sein möchten.<br />
De Land steht nicht für schnelles Geld und ein<br />
Jetset-Leben. Vielmehr steht er für Markt-Distanz<br />
innerhalb desselben sowie für ein integratives Verständnis<br />
der Galerie als eines Ortes, an dem man das,<br />
was Kunst genannt wird, in einer engen Interaktion<br />
zwischen Künstlern, Galeristen, Kritikern und<br />
Sammlern gemeinsam herstellt.<br />
Der Grund für die anhaltende Attraktivität hängt<br />
also mit einem offeneren Begriff dessen zusammen,<br />
was eine Galerie gegenwärtig sein kann und muss.<br />
»Die Rollen im Kunstbetrieb mischen sich immer<br />
mehr, und eine Galerie ist ein sehr flexibles Format«,<br />
sagt Zeidler, die vor ihrem Einstieg in die Galerie als<br />
Kuratorin tätig war. In einer Landschaft zwischen<br />
notorisch unterfinanzierten und wenig risikobereiten<br />
Kunstinstitutionen stellt der Weg ins selbstständige<br />
(und nicht selten selbstausbeuterische)<br />
Unternehmertum oft die einzige Möglichkeit dar,<br />
einer neuen, eigenen Kunst zum Durchbruch zu<br />
verhelfen. Nicht wenige Idealisten haben deswegen<br />
inzwischen die Seiten gewechselt. »Wer früher Kurator<br />
oder Ausstellungsmacher war, ist heute Galerist«,<br />
sagt auch Waling Boers, der in der zweiten<br />
Hälfte der neunziger Jahre den bekannten Berliner<br />
Projektraum Büro Friedrich betrieb und seit 2005<br />
zusammen mit seinem Partner Pi Li die international<br />
erfolgreiche Galerie Boers-Li in Peking führt.<br />
Boers hatte es irgendwann satt, bei lokalen Verwaltungen<br />
um Geld für seinen Projektraum zu betteln.<br />
Die Arbeit als Galerist bedeutet für ihn finanzielle<br />
Unabhängigkeit: »Schwierige Kunst zu popularisieren<br />
– das machen die Galerien heute besser.«<br />
Wie Boers haben die meisten seiner Kollegen ein<br />
Vorleben im Betrieb. In Galerien oder Museen haben<br />
sie das Handwerk gelernt und Kontakte geknüpft.<br />
»Ein gutes Adressbuch ist schon wichtig«, sagt Christine<br />
Heidemann, die in Berlin seit 2009 ihre Galerie<br />
Reception betreibt. Zuvor war die promovierte<br />
Kunsthistorikerin als freie Kuratorin tätig und jobbte<br />
in Galerien. »Es hat mich irgendwann angestrengt,<br />
sich immer wieder an unterschiedliche Orten und<br />
Gegebenheiten anpassen zu müssen.« Sie sei eine<br />
»promovierte Galeristin«, sagt Heidemann und<br />
meint damit die geschmeidige Verbindung von<br />
Marktpräsenz und intellektuellem Anspruch.<br />
Ohne finanzielles Backing – durch Kredite,<br />
Erbschaften oder häufig auch durch stille Teilhaber<br />
– geht es gerade für junge Galerien nicht.<br />
Um am Markt durchzuhalten, braucht man<br />
Startkapital. Und das nicht zu knapp. Ausstellungs-<br />
und Lagerräume müssen gemietet werden,<br />
Computer angeschafft werden; Sammleressen<br />
müssen veranstaltet, Produktionskosten vorfinanziert<br />
werden. Vor allem aber schlagen die<br />
kostspieligen Messebeteiligungen zu Buche. »Auf<br />
Messen zu gehen ist extrem wichtig, um ernst<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 55<br />
Der Beruf des Galeristen ist der neue Traumjob im Kunstbetrieb. Doch wie wird man einer? VON DOMINIKUS MÜLLER UND KITO NEDO<br />
Agenten der<br />
Kunst: Die<br />
Berliner<br />
Galeristen<br />
Nadine<br />
Zeidler und<br />
Amadeo<br />
Kraupa-<br />
Tuskany<br />
genommen zu werden, auch in ökonomischer<br />
Hinsicht«, berichtet Heidemann. Eine verhältnismäßig<br />
junge und kleine Verkaufsveranstaltung<br />
wie die gerade zu Ende gegangene Berliner ABC<br />
ist mit 4000 Euro Teilnahmegebühr je ausgestelltem<br />
Künstler verhältnismäßig günstig. Für die<br />
Teilnahme auf großen Messen wie der Art Basel<br />
muss man gut und gern das Zehnfache investieren<br />
– wenn man eine der begehrten Zulassungen<br />
bekommt. Gerade in der notorisch klammen<br />
Stadt Berlin verspricht die Kombination aus<br />
Messeteilnahme und Verkäufen über das Internet<br />
den Erfolg: Kontakte knüpft man persönlich,<br />
dann schickt man ein Angebot via E-Mail hinterher.<br />
Im besten Fall beginnen danach die Geräte<br />
zu summen. »Wir haben schon in viele Städte<br />
verkauft«, sagt Kraupa-Tuskany, »aber nach Berlin<br />
bislang noch nichts.«<br />
ZAHL DER WOCHE<br />
20 000<br />
… Objekte hat die Warhol Foundation bei<br />
Christie’s eingeliefert. Die Stiftung trennt<br />
sich von ihrer Sammlung, um den Erlös, der<br />
auf mehr als 100 Millionen Dollar geschätzt<br />
wird, in Künstlerstipendien zu stecken.<br />
Nach einer Auktion in New York im<br />
November werden die meisten Lose von<br />
Februar an online versteigert.<br />
TRAUMSTÜCK<br />
Dürers »Schaustellung<br />
Christi« aus der Großen<br />
Holzschnittpasssion<br />
Ecce homo!<br />
Die Spekulanten haben Albrecht<br />
Dürer noch nicht entdeckt<br />
Kann man sich einen Dürer leisten? Ja, man kann.<br />
Auch in dem überhitzten Kunstmarkt von heute<br />
gibt es Bereiche, in denen erstrangige Werke größter<br />
Künstler zu vergleichsweise moderaten Preisen<br />
gehandelt werden; vielleicht weil sie ein Minimum<br />
an Kenntnis verlangen und sich nicht dekorativ an<br />
Wände hängen lassen. Einer dieser Bereiche ist die<br />
Alte Grafik (ein anderer die Kunst der Antike).<br />
Für die Kölner Auktion am 21. September lobt<br />
Venator & Haunstein eine Reihe von Kupferstichen<br />
und Holzschnitten Albrecht Dürers aus, darunter die<br />
komplette Kupferstichpassion von 1507–13, sechzehn<br />
gut erhaltene Blätter unterschiedlicher, aber stets kontrastreicher<br />
Druckqualität, zu einem Schätzpreis von<br />
15 000 Euro. Es werden aber auch Einzelblätter aus<br />
den beiden anderen Passionszyklen Dürers angeboten,<br />
aus der Kleinen Holzschnittpassion von 1511 und<br />
aus der kunsthistorisch berühmtesten, der Großen<br />
Holzschnittpassion von 1510. Letztere, in ihrem für<br />
die Zeit spek takulären Format von circa <strong>39</strong> mal 28<br />
Zentimetern, zeigen alle staunenswerten Neuerungen<br />
der Dürerschen Holzschnitttechnik, vor allem die<br />
bezwingende Plastizität durch Mitteltonschraffuren.<br />
Es sind Illustrationen zu einem lateinischen Text<br />
des humanistisch gebildeten Mönchs Benedikt<br />
Schwalbe, der die Passion Christi nicht aus der Bibel,<br />
sondern mit zeitgenössischen Nachdichtungen der<br />
Renaissance erzählt – Jesus ist hier vor allem Mensch<br />
mit menschlichen Empfindungen –, und dementsprechend<br />
zeitgenössisch gestaltet Dürer die Szenen<br />
und Figuren. Die Leiden Christi werden so nah wie<br />
möglich gerückt – als lautete das Motto »Jesu, wenn<br />
er heute lebte«. Mein Lieblingsblatt ist Die Schaustellung<br />
Christi, also jene Szene, in der Pontius Pilatus,<br />
der sich ums Urteil drückt, den gefangenen Jesus dem<br />
Volk zeigt, mit den seither geflügelten Worten: »Ecce<br />
homo« – »Seht, ein Mensch!«<br />
Das Blatt, dessen einzige Makel kleine Restaurierungen<br />
und ein Beschnitt des linken Randes<br />
über die Einfassungslinie hinaus sind, wird mit<br />
1200 Euro angeboten. Selbst wenn sich der Schätzpreis<br />
in der Auktion verdoppeln oder verdreifachen<br />
würde, bekäme man noch immer das Meisterwerk<br />
eines der größten Meister der Kunstgeschichte<br />
für eine Summe, für die man auf dem<br />
Schrottplatz der Gegenwartskunst nur ein höhnisches<br />
Lachen hören würde. – Die übrigen Dürer-<br />
Grafiken in der Auktion sind auf 750 bis 2000<br />
Euro geschätzt. JENS JESSEN<br />
Foto: Christoph Neumann für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/christoph-neumann.com, Kunstwerk im Hintergrund: »Hanging low (bitter sweet), <strong>2012</strong>, von Slavs and Tatars; Abb.: Venator & Hanstein KG



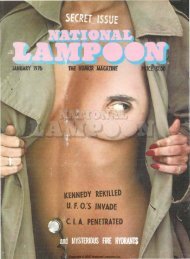

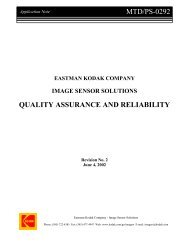
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

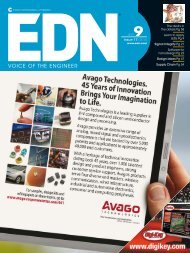

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)