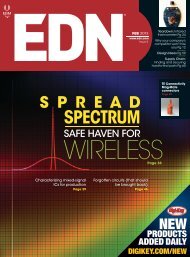DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
POLITIK<br />
Peking<br />
Es ist, als habe man dem Volkszorn einen<br />
Zoo gebaut, mit Zäunen und mit<br />
vielen Wärtern. Die Wutbürger marschieren<br />
in abgesteckten Bahnen vor<br />
der japanischen Botschaft auf und ab,<br />
beobachtet von Polizisten und Sondereinsatztruppen,<br />
am Himmel kreist ein Helikopter. Tausende<br />
protestieren hier, das Spektrum reicht vom<br />
Wanderarbeiter mit gelbem Bauhelm bis zur wie<br />
für einen Auftritt geschminkten Studentin.<br />
Es ist Dienstag, der 18. September, Jahrestag<br />
der japanischen Invasion Chinas 1931. Immer<br />
schon ein bitteres Datum, aber heute geht es<br />
um die Gegenwart, um einige winzige Inseln im<br />
Ostchinesischen Meer, wegen derer sich China<br />
und Japan gerade am Rand eines militärischen<br />
Konfliktes bewegen.<br />
»Die Diaoyu-Inseln sind unser«, rufen die<br />
Demonstranten. »Erklärt Japan den Krieg!« –<br />
»Nur mit den Gedanken des Großen Vorsitzenden<br />
werden wir Japan schlagen können«, steht<br />
auf einem Mao-Poster. »Massakriert Tokio!«,<br />
heißt es auf einem anderen Plakat. »Boykottiert<br />
japanische Waren!« Andere appellieren weniger<br />
martialisch an den »rationalen Patriotismus«.<br />
So heißt die offizielle Protesthaltung, ausgegeben<br />
von der chinesischen Regierung, nachdem<br />
es am Wochenende bei Demonstrationen in 85<br />
Städten zu Ausschreitungen gekommen war.<br />
Japaner wurden verprügelt, japanische Autos<br />
und Geschäfte demoliert, eine Toyota-Niederlassung<br />
in Tsingtao ging in Flammen auf. Die<br />
neue Praxis der staatlichen Zornkontrolle beobachtete<br />
die Hongkonger Zeitung Ming Pao<br />
am Wochenende, als Zivilpolizisten dem Demonstrationsvolk<br />
die Regeln erklärten: »Wir<br />
wissen, dass ihr sehr wütend seid, doch da draußen<br />
warten eine Menge ausländischer Journalisten.<br />
Zeigt die Qualität chinesischer Bürger.<br />
Singt die Nationalhymne. Lacht nicht, wenn<br />
ihr nicht lachen solltet. Und spielt nicht mit<br />
euren Handys.«<br />
Es sind die heftigsten antijapanischen Proteste,<br />
seit beide Länder im Jahr 1972 ihre Beziehungen<br />
normalisierten. Selbst die USA, die<br />
Chinas Streitigkeiten mit Nachbarn gern für<br />
ihre Zwecke nutzen, rufen zur Mäßigung<br />
auf. All das wegen einiger unbewohnter<br />
Inseln im Ostchinesischen Meer, die noch<br />
nicht einmal dem japanischen Staat, sondern<br />
einer Familie gehören?<br />
Senkaku nennen die Japaner die Inseln,<br />
Diaoyu heißen sie in China. Kontrolliert werden<br />
sie von Japan, was weder Peking noch Taiwan<br />
anerkennen. Die Chinesen bemühen Dokumente<br />
aus der Ming-Zeit, um ihre Ansprüche<br />
zu untermauern. Japan behauptet, sie 1884 entdeckt<br />
und keinerlei Spuren chinesischer Präsenz<br />
vorgefunden zu haben. Doch erst 1895, während<br />
des Ersten Japanisch-Chinesischen Krieges,<br />
verleibte sich Japan die Inseln ein. Nach der<br />
japanischen Kapitulation 1945 wurden sie von<br />
den USA kontrolliert, die sie 1972 an Japan zurückgaben<br />
– ohne dass die Souveränitätsfrage<br />
endgültig geklärt gewesen wäre. Ein heikler<br />
Schritt, zumal Öl- und Gasvorkommen in der<br />
Region vermutet werden.<br />
Doch Tokio und Peking verständigten sich<br />
prompt, dass der ungelöste Inselkonflikt die<br />
Beziehungen nicht belasten dürfte. Beide Seiten<br />
hielten sich daran – bis im Jahr 2010 ein chinesischer<br />
Fischer nahe der Inseln zwei japanische<br />
Patrouillenboote rammte. Wie betrunken der<br />
Mann war, ist bis heute umstritten. Jedenfalls<br />
löste seine Karambolage eine diplomatische Eskalation<br />
sondergleichen aus. Japan verhaftete<br />
den Seemann und weigerte sich, ihn auf Gesuch<br />
Chinas zu entlassen. Peking brach daraufhin<br />
die politischen Kontakte ab und stoppte<br />
den Export seltener Erden, welche der japanische<br />
Hightech-Sektor dringend benötigt. Eine<br />
Provokation gab die andere. Vergangene Woche<br />
schließlich kaufte die japanische Regierung der<br />
Familie die Inseln für 26 Millionen US-Dollar<br />
ab. Eigentlich eine Maßnahme der De es ka lation,<br />
denn die Regierung kam damit dem ultrarechten<br />
Gouverneur von Tokio als Käufer zuvor.<br />
Doch Peking und die chinesische Presse<br />
waren nicht mehr zu besänftigen.<br />
Sie wollen sich derzeit auch gar nicht besänftigen<br />
lassen. Die nationalistische Aufwallung<br />
kommt einer von Skandalen und Krisen geplagten<br />
Parteiführung durchaus gelegen, die zudem<br />
Winken von der Brücke<br />
Silvio Berlsuconi droht Italien mit einem Comeback. Vorher will er noch<br />
rasch den letzten unabhängigen Fernsehsender kaufen VON BIRGIT SCHÖNAU<br />
Rom<br />
Während seines Jurastudiums hatte Silvio<br />
Berlusconi auf Kreuzfahrtschiffen als<br />
Sänger gearbeitet, ein halbes Jahrhundert<br />
ist das her. Dass er jetzt nach Monaten in der<br />
politischen Versenkung auf der schneeweißen<br />
Divina (»die Göttliche«) sein Comeback verkünden<br />
wollte, erschien fast wie eine nostalgische<br />
Anwandlung: Mit 76 Jahren noch einmal dahin,<br />
wo alles begann, zu einem neuen Anfang. Daraus<br />
wurde nichts, was nicht nur daran lag, dass das<br />
Kreuzen auf dem Mittelmeer seit dem unrühmlichen<br />
Ende der Costa Concordia seinen Nimbus<br />
verloren hat. Auf der Divina reisten Leser des<br />
Berlusconi-Kampfblatts Il Giornale, die Kabine<br />
gab’s ab 980 Euro die Woche, den Ex-Premier als<br />
Stargast gratis dazu. Berlusconi schiffte sich in<br />
Venedig als Verheißung ein und ging in Bari als<br />
unerfülltes Versprechen von Bord. Denn selbst<br />
vor kleinem Publikum im Schiffstheater hatte er<br />
sich nicht durchringen können, seine Kandidatur<br />
für die Wahl im April 2013 anzukündigen.<br />
Halbherzig klang das Bekenntnis: »Ich fühle<br />
die Pflicht, zu verhindern, dass Italien der Linken<br />
anheimfällt.« Schal tönten die üblichen Wahlversprechen:<br />
Steuern senken, die neue Immobiliensteuer<br />
ganz abschaffen, »denn das Eigenheim ist<br />
das Fundament der italienischen Familie«. Montis<br />
Sparpolitik aber verhindere Wachstum und<br />
treibe Italien in die Rezession. Schuld daran seien<br />
jene Deutschen, die verhindern, dass die EZB<br />
»endlich Geld drucken kann«. Die deutsche<br />
Sparsucht laste auf Italien »wie ein Stein«.<br />
Während der Patriarch des »Freiheitsvolkes«<br />
gegen den Fiskalpakt wettert, haben seine Parlamentarier<br />
noch jedes Spargesetz der Regierung<br />
verabschiedet. Seit Berlusconis Rücktritt vor<br />
zehn Monaten unterstützt Parteisekretär Angelino<br />
Alfano den parteilosen Mario Monti im Verein<br />
mit dem Demokraten-Chef Pierluigi Bersani,<br />
einem Ex-Kommunisten.<br />
Alfano sei »der beste Politiker Italiens«, lobte<br />
Berlusconi vom Kreuzfahrtschiff. »Ich liebe ihn wie<br />
ein Vater seinen Sohn, und er bringt mir die Liebe<br />
eines Sohnes entgegen.« Demütig verharrt der<br />
41-Jährige Sizilianer in Wartestellung, bis sein Chef<br />
über die Kandidatur entscheidet. Wenn die Umfragewerte<br />
weiter im Keller bleiben, ist der getreue<br />
Vasall Alfano dran. Oder wenn das Mitte-Links-<br />
Bündnis tatsächlich Matteo Renzi, den jungen<br />
populären Bürgermeister von Florenz, als Kandidaten<br />
aufstellen würde: Gegen einen 37-jährigen<br />
würde Berlusconi wohl kaum antreten.<br />
Renzi tourt derzeit im Vorwahlkampf mit einem<br />
Wohnmobil durchs Land, Berlusconi<br />
kommt gerade aus dem gemeinsamen Urlaub in<br />
Kenia mit seinem Freund Flavio Briatore, einem<br />
Sportmanager, der zwischen Glamour und Halbwelt<br />
zu Hause ist und nach einer Sperre durch<br />
den Formel-1-Dachverband FIA ebenfalls an<br />
seinem Comeback feilt.<br />
Berlusconi und Briatore, das war das Italien<br />
der unaufhaltsamen Aufstiege, der zwielichtigen<br />
Geschäfte und schillernden Partys. Ein Italien,<br />
das jetzt hinter den grauen Kulissen der Rezession<br />
verblasst. Briatore hat seinen Klub Billionaire an<br />
der Costa Smeralda auf Sardinien geschlossen,<br />
gerade noch rechtzeitig, bevor die sardischen<br />
Kohle- und Metallarbeiter aus Angst um ihre Arbeitsplätze<br />
vergangene Woche in Rom Krawall<br />
schlugen. Berlusconi wurde am vergangenen Freitag<br />
ebenfalls in der Hauptstadt zum Fest der<br />
rechtskonservativen Jugendorganisation Giovane<br />
Italia erwartet. Im letzten Moment sagte er ab,<br />
vielleicht um lästigen Fragen auszuweichen. In<br />
Latium, der Region um Rom, versinkt das dort<br />
mit Rechtsextremen regierende »Freiheitsvolk« in<br />
einem Skandal um veruntreute Millionen aus der<br />
Parteikasse. Berlusconi schweigt dazu. Er konzentriert<br />
sich im Moment auf eigene Geschäfte.<br />
Sein Fernsehunternehmen Mediaset will von<br />
Telecom Italia den Sender La 7 übernehmen, das<br />
letzte landesweite unabhängige Fernsehen in Italien.<br />
Zu La 7 sind viele kritische Journalisten abgewandert,<br />
die sich nun entsetzt sind angescihts einer<br />
möglichen Übernahme durch Berlusconi. Selbst der<br />
erzkonservative Austroamerikaner Rupert Murdoch<br />
wäre der Belegschaft von La 7 als neuer Besitzer<br />
lieber. Die Schlacht um den Sender wird zeigen, wie<br />
weit Silvio Berlusconis Macht in Italien noch reicht.<br />
Felsen der<br />
Schande<br />
Droht ein Krieg? China und Japan streiten sich um<br />
fünf unbewohnte Inseln. Der<br />
Führung in Peking kommt das sehr gelegen<br />
CHINA<br />
VON ANGELA KÖCKRITZ<br />
JAPAN<br />
noch den internen Machtwechsel vorbereiten<br />
muss. Bloß lassen sich solche Aufwallungen<br />
nicht einfach wieder abstellen –<br />
schon gar nicht, wenn es gegen Japan geht.<br />
Japan ist der Hauptaggressor im chinesischen<br />
Narrativ von den hundert Jahren nationaler<br />
Erniedrigung. Die Kriege, die es beschreibt,<br />
sind nicht erfunden, das Trauma, das diese auslösten,<br />
ebenso wenig. Da waren zunächst die verlorenen<br />
Opiumkriege gegen die Briten, die das<br />
Kaiserreich Mitte des 19. Jahrhunderts bezwangen<br />
und Chinas jahrtausendealtes Selbstbild, die<br />
einzige wirkliche Großmacht auf Erden zu sein,<br />
zerstörten. Dann besiegte Japan, ehemals Tributstaat,<br />
das Kaiserreich im Ersten Japanisch-chinesischen<br />
Krieg von 1894 bis 1895 – und marschierte<br />
einige Jahrzehnte später auch noch in<br />
China ein. Der antijapanische Widerstandskampf<br />
während des Zweiten Weltkriegs war in<br />
gewisser Weise die Geburtsstunde der Volksrepublik.<br />
Erst durch den Widerstand konnten die<br />
Kommunisten die Sympathie der Massen gewinnen,<br />
die sie später zum Sieg gegen die Kuomintang<br />
tragen sollte. »Die Japaner besiegen und die<br />
Nation retten« wurde zum Gründungsmythos<br />
des jungen kommunistischen Staates. Mao befreite<br />
die Na tion aus den Ketten fremder Unterdrücker,<br />
er beendete das »Jahrhundert nationaler<br />
Erniedrigung« – auch wenn später Millionen im<br />
Zuge ihrer »Befreiung« ihr Leben lassen sollten.<br />
Den Nationalismus anzufächeln, hat sich für<br />
die Partei immer wieder als nützliche Strategie<br />
erwiesen. Nach dem Massaker 1989 auf dem<br />
Tiananmen-Platz bekämpfte die KP den öffentlichen<br />
Schock erfolgreich mit einem Trauerverbot<br />
für die erschossenen Demonstranten – und<br />
mit verordnetem Gedenken an die Opfer der<br />
Opiumkriege und der japanischen Invasion.<br />
Nun also der Kampf um Diaoyu mit den Mitteln<br />
des »rationalen Patriotismus«. Zu denen zählen<br />
offenbar auch sechs chinesische Patrouillenboote,<br />
die mit 1000 Fischkuttern im Schlepptau<br />
auf dem Weg zu den umstrittenen Inseln sind.<br />
Das zieht Aufmerksamkeit ab von dem immer<br />
noch nicht ausgestandenen Politskandal um den<br />
ehrgeizigen Provinzfürsten Bo Xilai, dessen Frau<br />
gerade wegen Mordes an einem britischen Ge-<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 9<br />
schäftsmann verurteilt wurde. Und vom Sohn<br />
eines Spitzenpolitikers, der kürzlich unbekleidet<br />
im Sportwagen und in Begleitung zweier halbnackter<br />
Frauen in den Tod raste. Schließlich verschwand<br />
auch noch der designierte Präsident Xi<br />
Jinping zwei Wochen lang von der Bildfläche.<br />
Das patriotische Theater lenkt nicht nur das Volk<br />
ab, es soll auch die Armee beschäftigt halten. Einige<br />
hochrangige Militärs gelten als Verbündete<br />
des gefallenen Provinzfürsten Bo, da kann es<br />
nicht schaden, etwaige unzufriedene Gemüter<br />
mit ein wenig Säbelrasseln zu beruhigen.<br />
Und doch hat der Nationalismus längst eine<br />
eigene Dynamik entwickelt, in der die Partei<br />
nicht mehr nur Antreiber, sondern manchmal<br />
auch Getriebener ist. Inzwischen hat sich ein patriotischer<br />
Diskurs gebildet sowie eine nationalistische<br />
Gemeinde, die Websites betreibt, politischen<br />
Druck ausübt und bisweilen der Regierung<br />
ihren Willen aufzwingt.<br />
Genau das macht das nationale Motiv der<br />
kollektiven Erniedrigung so gefährlich. Japan<br />
gibt den Chinesen dabei reichlich Anlass, sich zu<br />
empören. Die japanische Regierung entschuldigte<br />
sich nur zögerlich für die Gräueltaten während<br />
der Besatzung, die japanische Rechte bohrt bis<br />
heute gern in den chinesischen Wunden. Aber<br />
die ewige chinesische Propaganda von der historischen<br />
»Erniedrigung« provoziert gefährliche<br />
Rachebedürfnisse. »Sollte es einen neuen Krieg<br />
zwischen China und Japan geben«, schrieb unlängst<br />
die parteinahe Global Times, »muss es ein<br />
Krieg sein, durch den das chinesische Volk die<br />
Schande des vergangenen Jahrhunderts psychologisch<br />
reinwaschen kann.« Territoriale Kompromisse<br />
zugunsten Japans, so die Zeitung, würden<br />
China »doppelte Schande bringen«.<br />
Weder Peking noch Tokio wollen Krieg. Aber<br />
beide Seiten haben den Konflikt so weit eskalieren<br />
lassen, dass ein ungeplanter Zwischenfall –<br />
und sei es nur wieder ein betrunkener Fischer –<br />
unkontrollierbare Folgen haben könnte. Eine<br />
Demonstration kann man einzäunen. Den geballten<br />
Volkszorn eines ganzen Landes womöglich<br />
nicht.<br />
A www.zeit.de/audio


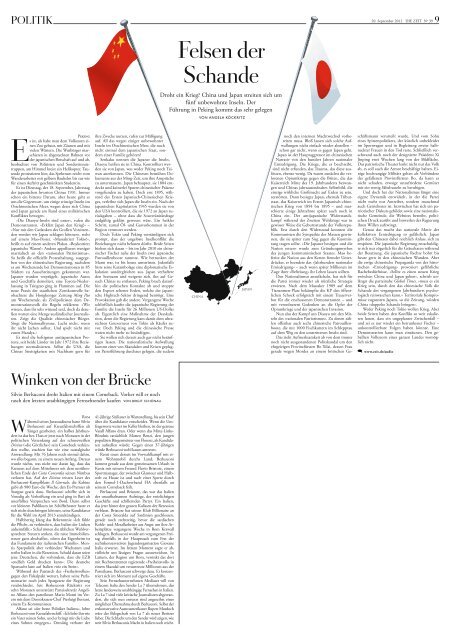
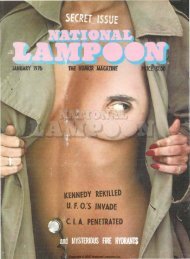

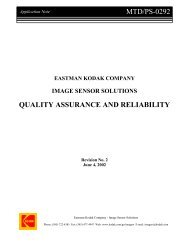
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

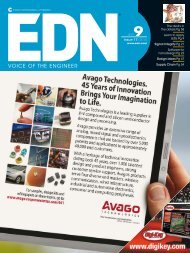

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)