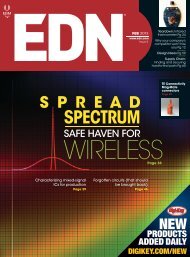DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Illustration: Anne Gerdes für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong><br />
74 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
100 Jahre sollten sie halten<br />
Aber viele Brücken sind dem heutigen Verkehr nicht mehr gewachsen. Dann sind die Rechenkünste von Bauingenieuren gefragt VON CHRISTINE BÖHRINGER<br />
Wenn Gunnar Schönherr über<br />
neue Brücken fährt, dann fühlt er<br />
sich manchmal wie im Himmel:<br />
Auf dem Viadukt von Millau<br />
etwa, der längsten Schrägseilbrücke<br />
der Welt, hat man, sobald sich tief unten im<br />
südfranzösischen Tal des Flusses Tarn der Nebel<br />
staut, den Eindruck, man gleite auf den Wolken.<br />
Sind die Brücken jedoch alt, kehrt Schönherr ganz<br />
schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück:<br />
Automatisch scannt er die Bauwerke nach<br />
Schwachstellen ab. Ist eine Brücke für Laster über<br />
30 Tonnen gesperrt, muss er gar nicht erst weiter<br />
schauen. Dann weiß er: Sie ist noch verkehrssicher,<br />
aber marode – und die ihr verbleibenden Tage sind<br />
längst gezählt.<br />
Gunnar Schönherr, 33, ist Bauingenieur. Er<br />
konstruiert neue Brücken – und er berechnet, wie<br />
lange die alten noch halten werden. Rund 120 000<br />
Brücken gibt es in Deutschland, allein 37 000 verbinden<br />
Bundesstraßen und Autobahnen, die meisten<br />
wurden zwischen Mitte der sechziger und Mitte<br />
der achtziger Jahre errichtet. »Eigentlich wurden<br />
sie für die nächsten hundert Jahre gebaut«, sagt<br />
Gunnar Schönherr. Doch damals, bei ihrer Planung,<br />
legte man die meisten von ihnen für viel geringere<br />
Lasten aus, als sie heute tragen müssen.<br />
Denn eines hatte man nicht mit einkalkuliert: Es<br />
gibt mehr Verkehr als früher, besonders der Schwerverkehr<br />
hat überproportional stark zugenommen.<br />
Weil aber 40-Tonner auf Dauer die Substanz zermürben,<br />
werden die Brücken von Ingenieuren alle<br />
drei Jahre einer kleineren und alle sechs Jahre einer<br />
großen Prüfung unterzogen.<br />
Zwanzig Brücken hat Gunnar Schönherr, der<br />
2008 nach seinem Abschluss an der TU Berlin bei<br />
einem Planungsbüro einstieg, bislang gemeinsam<br />
mit Kollegen besichtigt. An das erste Mal kann er<br />
sich noch gut erinnern: die Zoobrücke in Köln,<br />
259 Meter Spannweite, fertiggestellt 1966, überquert<br />
von täglich 125 000 Fahrzeugen, getragen<br />
von zwei Stahlhohlkästen. Um alle Bauteile zu begutachten,<br />
muss man schwindelfrei sein und sich<br />
auf eine Art Laufsteg direkt unter der Fahrbahn<br />
hoch über dem Rhein stellen. »Brücken werden aus<br />
Beton und Stahl gebaut, weil Beton besonders gut<br />
Spannungen durch Druck aufnehmen kann. Stahl<br />
kann das auch, aber noch besser Spannungen durch<br />
Zug.« Sehen die Ingenieure bei ihrer Besichtigung<br />
Rost, ist das kein Problem – die Stellen können<br />
ausgebessert werden. Sehen sie hingegen Risse, ist<br />
das Material ermüdet, der Zug oder Druck zu groß.<br />
Dass bei einer Brücke etwas nicht stimmt, merken<br />
dann auch die Autofahrer: Ist plötzlich in beide<br />
Richtungen eine Fahrbahn für Lastwagen gesperrt<br />
oder sollen jetzt alle statt 50 Stundenkilometer nur<br />
noch 30 fahren, ist das der Versuch, die Brücke zu<br />
schonen, um dadurch ihre Lebensdauer zu verlängern.<br />
Im Hintergrund arbeiten die Ingenieure fieberhaft:<br />
»Wir ermitteln bei jeder beschädigten<br />
Brücke, wie lange man sie noch nutzen kann«, erklärt<br />
Schönherr. »Anhand der alten Pläne und der<br />
Verkehrsstatistik können wir dann zum Beispiel<br />
sagen: Die Last kann die Brücke noch 100 000 Mal<br />
tragen, dann ist Schluss. Das ist wie bei einer Büroklammer:<br />
Wenn man sie zu oft biegt, bricht sie irgendwann<br />
entzwei.« Es werden Überholverbote,<br />
Geschwindigkeits- und Gewichtsbeschränkungen<br />
eingeführt – und es wird versucht, die Brücke zu<br />
verstärken. Allein im vergangenen Jahr stellte der<br />
Bund 674 Millionen Euro für solche Sanierungen<br />
bereit. Hilft auch das nichts, kommen irgendwann<br />
die Abrissbagger – wie bei der Köhlbrandbrücke in<br />
Hamburg. Sie führt durch den Hafen und soll bald<br />
durch eine neue ersetzt werden.<br />
Die passende Lösung für eine Brücke zu finden<br />
ist für Schönherr oft »richtige Detektivarbeit«.<br />
Doch genau die mag er. Wurde die Brücke etwa<br />
falsch konstruiert? Oder ist sie dem aktuellen Verkehr<br />
nicht mehr gewachsen? Schon während seiner<br />
kaufmännischen Lehre bei einem Baubetreuer wurde<br />
er neugierig auf Materialien und wollte wissen,<br />
warum sich Stahl im Beton befindet, Gebäude<br />
überhaupt stehen bleiben und wofür man welche<br />
Baustoffe braucht. Er begann zu studieren – und<br />
spezialisierte sich auf Brücken. »Anders als bei Häusern<br />
ist ihre Konstruktion den Ingenieuren vorbehalten.<br />
Ich sehe, was ich tue, und trage dazu bei, die<br />
Infrastruktur aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.«<br />
Das beste Anschauungsbeispiel fand<br />
Schönherr in der Heimat: In seiner Studienzeit wurde<br />
die Rügenbrücke zwischen das Festland und die<br />
Insel gesetzt. Ein 4,1 Kilometer langes, spektakuläres<br />
Werk aus 180 000 Tonnen Beton und 22 000<br />
Tonnen Stahl. Alle zwei Wochen fuhr Schönherr<br />
hin und beobachtete, wie Pfeiler aus dem Strelasund<br />
und Pylonen in den Himmel wuchsen. »Die Rügenbrücke<br />
vereint alles, was der Brückenbau bietet,<br />
da hätte ich am liebsten mitgewerkelt.«<br />
Wenn Schönherr selbst Brücken konstruiert,<br />
tut er das hingegen noch in anderen Dimensionen:<br />
Er hat bislang fünf Fußgänger- und Straßenbrücken<br />
entworfen, alle nicht mehr als 60 Meter lang.<br />
»Man fängt klein an«, sagt Schönherr. Und doch<br />
ist es auch hier nicht anders als bei den Großen:<br />
Ein Anfangs- und ein Endpunkt müssen so wirt-<br />
SPEZIAL: INGENIEURE UND TECHNIKER<br />
schaftlich wie möglich miteinander verbunden<br />
werden. Was dazwischen liegt, soll gut aussehen,<br />
in die Landschaft passen – und halten. Drei Monate<br />
vergehen von der ersten Idee bis zur Berechnung,<br />
diese schafft der Bauingenieur dann in vier<br />
Wochen. Steht die Brücke schließlich, erlebt<br />
Schönherr immer wieder einen Aha-Effekt und ist<br />
von dem, was aus seiner Zeichnung wurde, begeistert:<br />
»Eine Brücke ist wie ein eigenes Baby«,<br />
sagt er – und das wird, wenn alles glatt geht, mindestens<br />
100 Jahre alt.<br />
»Ein Drittel ist grauenvoll«<br />
Ein 50 Jahre alter Ingenieur sagt, wie es ist, heute noch einmal zu studieren<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Sie sind 50 Jahre alt, Diplom-Ingenieur<br />
und Vater von drei Kindern. Warum machen Sie<br />
jetzt noch einen Master of Engineering?<br />
Stephan Fischer: Ich wollte in der Mitte des Arbeitslebens<br />
noch mal neuen Input bekommen und<br />
mein Wissen auffrischen. Mittlerweile studiere ich<br />
seit anderthalb Jahren, das heißt im vierten und<br />
letzten Semester, und habe viel Spaß an den Fächern,<br />
die ich in meinem ersten Studium nicht<br />
gemacht habe. Manche gab es damals noch gar<br />
nicht, zum Beispiel Baumanagement. Das hat sich<br />
in den letzten Jahren sehr entwickelt. Auch Brandschutz<br />
gehört dazu.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie haben ein Ingenieurbüro. Wie schaffen<br />
Sie das Studium nebenher?<br />
Fischer: Ich betreibe mein Büro nicht in Vollzeit<br />
und stimme die Termine mit den Vorlesungen<br />
ab. Als die Kinder noch klein waren, habe ich<br />
einen Deal mit meiner Frau gemacht, der beinhaltete,<br />
dass sie als Lehrerin voll in den Beruf<br />
einstieg. Mittlerweile sind unsere Kinder aber<br />
groß. Ich kann mich jetzt also auf den Master<br />
konzentrieren.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie unterscheidet sich das heutige Ingenieursstudium<br />
vom damaligen?<br />
Fischer: Früher wurde zwar mehr Praxis vermittelt,<br />
es war aber noch verschulter. Man musste<br />
einfach einen Katalog an Vorlesungen abarbeiten,<br />
Scheine holen, Haken dran. Was früher Vorlesung<br />
hieß, heißt heute Modul. Im Master können<br />
wir jetzt je nach Interesse aus etwa 25 Modulen<br />
wählen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Finden Sie, das Masterstudium bereitet die<br />
Studenten genügend auf den Arbeitsalltag vor?<br />
Fischer: Zum Teil. Ein Drittel der Dozenten<br />
macht mit den Studenten Projekte, in denen sie<br />
mit realistischen Problemen konfrontiert werden.<br />
Ein weiteres Drittel der Dozenten macht ganz ordentliche<br />
Arbeit. Und bei einem Drittel ist es<br />
grauenvoll. An denen sind Pädagogik und Didaktik<br />
vorbeigegangen. Die geben einem die Formeln,<br />
und in der Klausur muss man dann nur Zahlen<br />
einsetzen und runterrechnen. In der Praxis aber<br />
kommt der Kunde mit einem statischen oder baurechtlichen<br />
Problem, und ich muss eine Lösung<br />
dafür finden. Darauf sollten die Studenten vorbereitet<br />
werden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Viele behaupten, der Dipl.-Ing. sei der bessere<br />
Abschluss gewesen. Wie sehen Sie das?<br />
Fischer: Als ich anfing, erneut zu studieren, dachte<br />
ich, mein Diplomstudium würde mir anerkannt<br />
werden. Es hieß ja, der Bachelor sei weniger wert<br />
als ein Fachhochschuldiplom. Stattdessen sagte<br />
man mir bei der Anmeldung für den Master, ich<br />
könne froh sein, dass ich nicht noch ein paar<br />
Credits nachholen müsse. Denn das In ge nieurstu<br />
dium ging bei mir damals offiziell nur über<br />
fünfeinhalb Semester, der Bachelor aber hat sechs<br />
Semester. Trotzdem denke ich, dass der Bachelor<br />
allein nicht erstrebenswert ist. Er ist sehr verschult.<br />
Man sollte immer noch den Master machen,<br />
dadurch kommt man auf eine ganz andere<br />
Wissensebene.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wissen Sie schon, was Sie nach dem Studium<br />
machen?<br />
Fischer: Ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig<br />
und habe noch mal etwa 15 Jahre Berufsleben vor<br />
mir. Ich kann mir vorstellen, nach dem Studium<br />
noch einmal bei einer Firma anzufangen. Vielleicht<br />
werde ich aber auch Lehrer für Mathe und<br />
Physik. Das geht in Hessen als Quereinsteiger. Es<br />
gefällt mir, jungen Menschen etwas beizubringen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Bringen Sie Ihren jungen Kommilitonen<br />
auch manchmal etwas bei?<br />
Fischer: Es ist schon so, dass ich immer mal Mails<br />
von Kommilitonen bekomme, die mich fragen, ob<br />
ich über eine Rechnung schauen kann oder was<br />
ich zu einer Lösung sage. Ich antworte gerne, denn<br />
wenn ich etwas erklären kann, heißt das, ich habe<br />
es verstanden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Widersprechen Sie den Dozenten auch mal?<br />
Fischer: Gelegentlich schon. Einmal hat der Professor<br />
eine Aufgabe zum Thema Bauablaufstörung<br />
ausgeteilt. Die Informationen waren unvollständig,<br />
auf dieser Basis hätte man als Ingenieur nicht<br />
anfangen können zu arbeiten. Das habe ich dann<br />
auch gesagt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und gehen Sie mit Ihren Kommilitonen<br />
auf Studentenpartys?<br />
Fischer: Auf einer großen Party war ich noch<br />
nicht, aber wir waren mal zusammen in der Kneipe,<br />
um das Semester nach den letzten Klausuren<br />
gemeinsam ausklingen zu lassen. Am Anfang war<br />
das für meine Kommilitonen, glaube ich, ein bisschen<br />
komisch: so ein alter Typ, der da rumsitzt.<br />
Vom Alter her könnten sie meine Kinder sein, zuerst<br />
haben sie mich gesiezt. Jetzt ist das ein ganz<br />
natürlicher Umgang miteinander. Ich frage sie<br />
auch manchmal nach den Unterlagen, wenn ich<br />
mal nicht da sein konnte. Ich bin einer von denen<br />
geworden.<br />
Stephan Fischer, 50, studiert Konstruktiver<br />
Ingenieurbau/Baumanagement an<br />
der Hochschule RheinMain in Wiesbaden<br />
Interview: ANIKA KRELLER<br />
CHANCEN



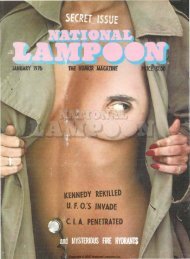

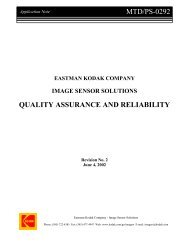
![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)

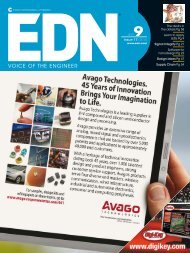

![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)