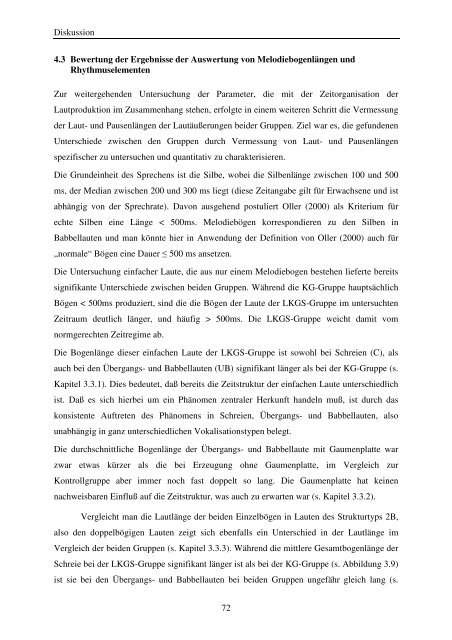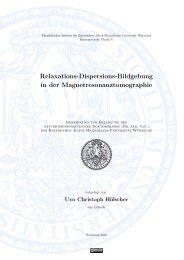Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diskussion<br />
4.3 Bewertung der Ergebnisse der Auswertung von Melodiebogenlängen und<br />
Rhythmuselementen<br />
Zur weitergehenden Untersuchung der Parameter, die mit der Zeitorganisation der<br />
Lautproduktion im Zusammenhang stehen, erfolgte in einem weiteren Schritt die Vermessung<br />
der Laut- und Pausenlängen der Lautäußerungen beider Gruppen. Ziel war es, die gefundenen<br />
Unterschiede zwischen den Gruppen durch Vermessung von Laut- und Pausenlängen<br />
spezifischer zu untersuchen und quantitativ zu charakterisieren.<br />
Die Grundeinheit des Sprechens ist die Silbe, wobei die Silbenlänge zwischen 100 und 500<br />
ms, der Median zwischen 200 und 300 ms liegt (diese Zeitangabe gilt für Erwachsene und ist<br />
abhängig von der Sprechrate). Davon ausgehend postuliert Oller (2000) als Kriterium für<br />
echte Silben eine Länge < 500ms. Melodiebögen korrespondieren zu den Silben in<br />
Babbellauten und man könnte hier in Anwendung der Definition von Oller (2000) auch für<br />
„normale“ Bögen eine Dauer 500 ms ansetzen.<br />
Die Untersuchung einfacher Laute, die aus nur einem Melodiebogen bestehen lieferte bereits<br />
signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Während die KG-Gruppe hauptsächlich<br />
Bögen < 500ms produziert, sind die die Bögen der Laute der LKGS-Gruppe im untersuchten<br />
Zeitraum deutlich länger, und häufig > 500ms. Die LKGS-Gruppe weicht damit vom<br />
normgerechten Zeitregime ab.<br />
Die Bogenlänge dieser einfachen Laute der LKGS-Gruppe ist sowohl bei Schreien (C), als<br />
auch bei den Übergangs- und Babbellauten (UB) signifikant länger als bei der KG-Gruppe (s.<br />
Kapitel 3.3.1). Dies bedeutet, daß bereits die Zeitstruktur der einfachen Laute unterschiedlich<br />
ist. Daß es sich hierbei um ein Phänomen zentraler Herkunft handeln muß, ist durch das<br />
konsistente Auftreten des Phänomens in Schreien, Übergangs- und Babbellauten, also<br />
unabhängig in ganz unterschiedlichen Vokalisationstypen belegt.<br />
Die durchschnittliche Bogenlänge der Übergangs- und Babbellaute mit Gaumenplatte war<br />
zwar etwas kürzer als die bei Erzeugung ohne Gaumenplatte, im Vergleich zur<br />
Kontrollgruppe aber immer noch fast doppelt so lang. Die Gaumenplatte hat keinen<br />
nachweisbaren Einfluß auf die Zeitstruktur, was auch zu erwarten war (s. Kapitel 3.3.2).<br />
Vergleicht man die Lautlänge der beiden Einzelbögen in Lauten des Strukturtyps 2B,<br />
also den doppelbögigen Lauten zeigt sich ebenfalls ein Unterschied in der Lautlänge im<br />
Vergleich der beiden Gruppen (s. Kapitel 3.3.3). Während die mittlere Gesamtbogenlänge der<br />
Schreie bei der LKGS-Gruppe signifikant länger ist als bei der KG-Gruppe (s. Abbildung 3.9)<br />
ist sie bei den Übergangs- und Babbellauten bei beiden Gruppen ungefähr gleich lang (s.<br />
72