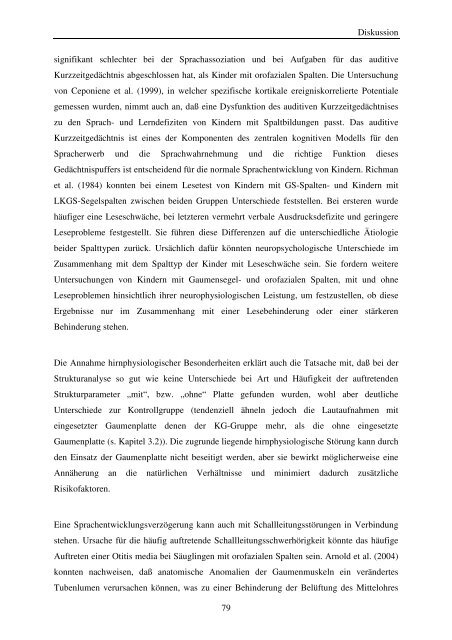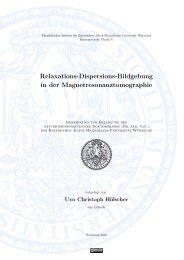Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
79<br />
Diskussion<br />
signifikant schlechter bei der Sprachassoziation und bei Aufgaben für das auditive<br />
Kurzzeitgedächtnis abgeschlossen hat, als Kinder mit orofazialen Spalten. Die Untersuchung<br />
von Ceponiene et al. (1999), in welcher spezifische kortikale ereigniskorrelierte Potentiale<br />
gemessen wurden, nimmt auch an, daß eine Dysfunktion des auditiven Kurzzeitgedächtnises<br />
zu den Sprach- und Lerndefiziten von Kindern mit Spaltbildungen passt. Das auditive<br />
Kurzzeitgedächtnis ist eines der Komponenten des zentralen kognitiven Modells für den<br />
Spracherwerb und die Sprachwahrnehmung und die richtige Funktion dieses<br />
Gedächtnispuffers ist entscheidend für die normale Sprachentwicklung von Kindern. Richman<br />
et al. (1984) konnten bei einem Lesetest von Kindern mit GS-Spalten- und Kindern mit<br />
LKGS-Segelspalten zwischen beiden Gruppen Unterschiede feststellen. Bei ersteren wurde<br />
häufiger eine Leseschwäche, bei letzteren vermehrt verbale Ausdrucksdefizite und geringere<br />
Leseprobleme festgestellt. Sie führen diese Differenzen auf die unterschiedliche Ätiologie<br />
beider Spalttypen zurück. Ursächlich dafür könnten neuropsychologische Unterschiede im<br />
Zusammenhang mit dem Spalttyp der Kinder mit Leseschwäche sein. Sie fordern weitere<br />
Untersuchungen von Kindern mit Gaumensegel- und orofazialen Spalten, mit und ohne<br />
Leseproblemen hinsichtlich ihrer neurophysiologischen Leistung, um festzustellen, ob diese<br />
Ergebnisse nur im Zusammenhang mit einer Lesebehinderung oder einer stärkeren<br />
Behinderung stehen.<br />
Die Annahme hirnphysiologischer Besonderheiten erklärt auch die Tatsache mit, daß bei der<br />
<strong>Strukturanalyse</strong> so gut wie keine Unterschiede bei Art und Häufigkeit der auftretenden<br />
Strukturparameter „mit“, bzw. „ohne“ Platte gefunden wurden, wohl aber deutliche<br />
Unterschiede zur Kontrollgruppe (tendenziell ähneln jedoch die Lautaufnahmen mit<br />
eingesetzter Gaumenplatte denen der KG-Gruppe mehr, als die ohne eingesetzte<br />
Gaumenplatte (s. Kapitel 3.2)). Die zugrunde liegende hirnphysiologische Störung kann durch<br />
den Einsatz der Gaumenplatte nicht beseitigt werden, aber sie bewirkt möglicherweise eine<br />
Annäherung an die natürlichen Verhältnisse und minimiert dadurch zusätzliche<br />
Risikofaktoren.<br />
Eine Sprachentwicklungsverzögerung kann auch mit Schallleitungsstörungen in Verbindung<br />
stehen. Ursache für die häufig auftretende Schallleitungsschwerhörigkeit könnte das häufige<br />
Auftreten einer Otitis media bei Säuglingen mit orofazialen Spalten sein. Arnold et al. (2004)<br />
konnten nachweisen, daß anatomische Anomalien der Gaumenmuskeln ein verändertes<br />
Tubenlumen verursachen können, was zu einer Behinderung der Belüftung des Mittelohres