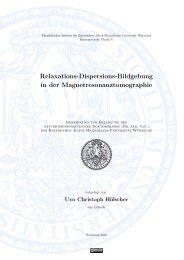Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
73<br />
Diskussion<br />
Abbildung 3.10). Unabhängig davon ergibt sich durch die unterschiedliche Länge des ersten<br />
und zweiten Melodiebogens sowohl bei den Schreien, als auch bei den Übergangs- und<br />
Babbellauten ein unterschiedlicher Rhythmus im Vergleich der beiden Gruppen. Die mittlere<br />
Länge des ersten Bogens ist bei der LKGS-Gruppe signifikant länger, als die Länge des<br />
zweiten Melodiebogens. Dies entspricht dem Rhythmus „lang-kurz“ (s. Tabelle 3.7). Bei der<br />
KG-Gruppe sind beide Bögen ungefähr gleich lang, was einem „kurz-kurz“ Rhythmus<br />
entspricht (s. Tabelle 3.8). Unterschiede fanden sich auch in den zweibögigen, bzw.<br />
zweisilbigen Übergangs- und Babbellauten. Während diese Laute bei der LKGS-Gruppe im<br />
Mittel einen „kurz-kurz“ Rhythmus zeigten, erzeugte die KG-Gruppe einen „kurz-lang“<br />
Rhythmus (s. Tabelle 3.9, Tabelle 3.10). Diese Unterschiede sind dahingehend zu deuten, daß<br />
die LKGS-Gruppe im Schrei das ursprünglichere, physiologisch leichter zu erzeugende „lang-<br />
kurz“ Muster beibehält (ein weiteres Argument für die postulierte<br />
Zeitverzögerungshypothese), übt die KG-Gruppe im Schreien schon gleichlange Bögen und<br />
in den Übergangs- und Babbellauten sogar endbetonte Bögen („kurz-lang“). Wenn auch<br />
dieses jambische Betonungsmuster zielsprachlich im Deutschen nicht vorherrschend erwartet<br />
wird, reflektiert es aus regelungstechnischer Perspektive eine erreichte höhere<br />
Organisationstiefe als ein trochäisches Muster. Da die muttersprachliche Betonung nicht<br />
durch die Bogenlänge allein sondern auch die Grundfrequenz und die Intensitätskontur<br />
erzeugt wird, steht der Befund nicht im Widerspruch zu Hinweisen auf muttersprachliche<br />
Betonungen in frühen Babblern (Penner et al., 2006).<br />
Auch bei den 3B-Strukturen ist wiederum die Gesamtlänge der Laute und zusätzlich<br />
die Einzelbogenlänge jedes der drei Bögen, sowohl bei Schreien, als auch bei Übergangs- und<br />
Babbellauten bei der LKGS-Gruppe länger (s. Kapitel 3.3.4). Neben der deutlich größeren<br />
Gesamtlänge der Laute der LKGS-Gruppe wurden auch auffällige Rhythmusunterschiede<br />
gefunden. Während bei der KG-Gruppe bei den Schreien die drei Einzelbögen kontinuierlich<br />
in der Länge abnehmen, ist der mittlere Bogen in der LKGS-Gruppe der längste, gefolgt vom<br />
ersten und dritten Melodiebogen. Bei den Übergangs- und Babbellauten ergibt sich bei der<br />
LKGS-Gruppe ein „lang-kurz-kurz“ Rhythmus und bei der KG-Gruppe ein „kurz-lang-mittel“<br />
Rhythmus (s. Abbildung 3.13). Die Tatsache, daß dieselben zeitlichen<br />
Organisationsprinzipien bei der KG-Gruppe bei den Übergangs- und Babbellauten sowohl bei<br />
den 2B-Strukturen, als auch bei den 3B-Strukturen gefunden wurden, ist ein starkes Argument<br />
für deren hirnphysiologische Verankerung. Der Rhythmus der LKGS-Gruppe weicht stark<br />
von dem der KG-Gruppe ab.