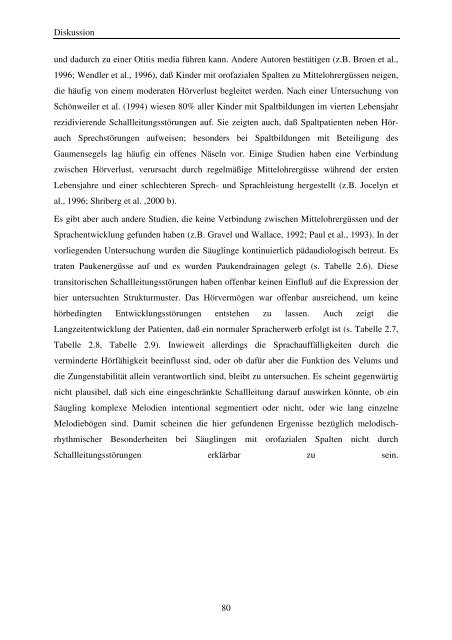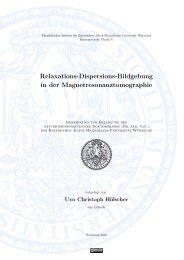Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diskussion<br />
und dadurch zu einer Otitis media führen kann. Andere Autoren bestätigen (z.B. Broen et al.,<br />
1996; Wendler et al., 1996), daß Kinder mit orofazialen Spalten zu Mittelohrergüssen neigen,<br />
die häufig von einem moderaten Hörverlust begleitet werden. Nach einer Untersuchung von<br />
Schönweiler et al. (1994) wiesen 80% aller Kinder mit Spaltbildungen im vierten Lebensjahr<br />
rezidivierende Schallleitungsstörungen auf. Sie zeigten auch, daß Spaltpatienten neben Hör-<br />
auch Sprechstörungen aufweisen; besonders bei Spaltbildungen mit Beteiligung des<br />
Gaumensegels lag häufig ein offenes Näseln vor. Einige Studien haben eine Verbindung<br />
zwischen Hörverlust, verursacht durch regelmäßige Mittelohrergüsse während der ersten<br />
Lebensjahre und einer schlechteren Sprech- und Sprachleistung hergestellt (z.B. Jocelyn et<br />
al., 1996; Shriberg et al. ,2000 b).<br />
Es gibt aber auch andere Studien, die keine Verbindung zwischen Mittelohrergüssen und der<br />
Sprachentwicklung gefunden haben (z.B. Gravel und Wallace, 1992; Paul et al., 1993). In der<br />
vorliegenden Untersuchung wurden die Säuglinge kontinuierlich pädaudiologisch betreut. Es<br />
traten Paukenergüsse auf und es wurden Paukendrainagen gelegt (s. Tabelle 2.6). Diese<br />
transitorischen Schallleitungsstörungen haben offenbar keinen Einfluß auf die Expression der<br />
hier untersuchten Strukturmuster. Das Hörvermögen war offenbar ausreichend, um keine<br />
hörbedingten Entwicklungsstörungen entstehen zu lassen. Auch zeigt die<br />
Langzeitentwicklung der Patienten, daß ein normaler Spracherwerb erfolgt ist (s. Tabelle 2.7,<br />
Tabelle 2.8, Tabelle 2.9). Inwieweit allerdings die Sprachauffälligkeiten durch die<br />
verminderte Hörfähigkeit beeinflusst sind, oder ob dafür aber die Funktion des Velums und<br />
die Zungenstabilität allein verantwortlich sind, bleibt zu untersuchen. Es scheint gegenwärtig<br />
nicht plausibel, daß sich eine eingeschränkte Schallleitung darauf auswirken könnte, ob ein<br />
Säugling komplexe Melodien intentional segmentiert oder nicht, oder wie lang einzelne<br />
Melodiebögen sind. Damit scheinen die hier gefundenen Ergenisse bezüglich melodisch-<br />
rhythmischer Besonderheiten bei Säuglingen mit orofazialen Spalten nicht durch<br />
Schallleitungsstörungen erklärbar zu sein.<br />
80