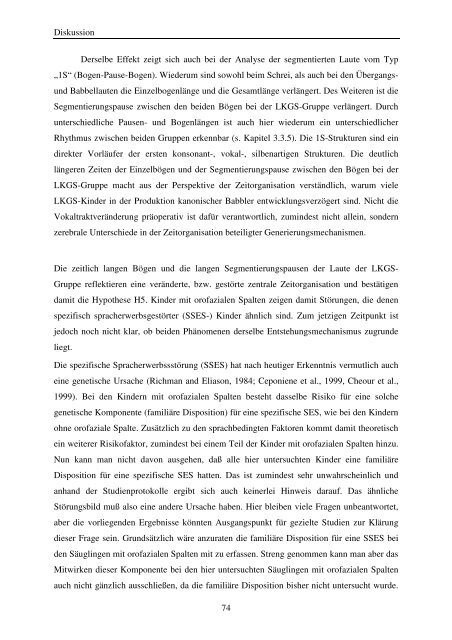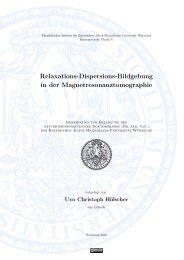Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Quantitative Strukturanalyse vorsprachlicher Vokalisationen - OPUS ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diskussion<br />
Derselbe Effekt zeigt sich auch bei der Analyse der segmentierten Laute vom Typ<br />
„1S“ (Bogen-Pause-Bogen). Wiederum sind sowohl beim Schrei, als auch bei den Übergangs-<br />
und Babbellauten die Einzelbogenlänge und die Gesamtlänge verlängert. Des Weiteren ist die<br />
Segmentierungspause zwischen den beiden Bögen bei der LKGS-Gruppe verlängert. Durch<br />
unterschiedliche Pausen- und Bogenlängen ist auch hier wiederum ein unterschiedlicher<br />
Rhythmus zwischen beiden Gruppen erkennbar (s. Kapitel 3.3.5). Die 1S-Strukturen sind ein<br />
direkter Vorläufer der ersten konsonant-, vokal-, silbenartigen Strukturen. Die deutlich<br />
längeren Zeiten der Einzelbögen und der Segmentierungspause zwischen den Bögen bei der<br />
LKGS-Gruppe macht aus der Perspektive der Zeitorganisation verständlich, warum viele<br />
LKGS-Kinder in der Produktion kanonischer Babbler entwicklungsverzögert sind. Nicht die<br />
Vokaltraktveränderung präoperativ ist dafür verantwortlich, zumindest nicht allein, sondern<br />
zerebrale Unterschiede in der Zeitorganisation beteiligter Generierungsmechanismen.<br />
Die zeitlich langen Bögen und die langen Segmentierungspausen der Laute der LKGS-<br />
Gruppe reflektieren eine veränderte, bzw. gestörte zentrale Zeitorganisation und bestätigen<br />
damit die Hypothese H5. Kinder mit orofazialen Spalten zeigen damit Störungen, die denen<br />
spezifisch spracherwerbsgestörter (SSES-) Kinder ähnlich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist<br />
jedoch noch nicht klar, ob beiden Phänomenen derselbe Entstehungsmechanismus zugrunde<br />
liegt.<br />
Die spezifische Spracherwerbssstörung (SSES) hat nach heutiger Erkenntnis vermutlich auch<br />
eine genetische Ursache (Richman and Eliason, 1984; Ceponiene et al., 1999, Cheour et al.,<br />
1999). Bei den Kindern mit orofazialen Spalten besteht dasselbe Risiko für eine solche<br />
genetische Komponente (familiäre Disposition) für eine spezifische SES, wie bei den Kindern<br />
ohne orofaziale Spalte. Zusätzlich zu den sprachbedingten Faktoren kommt damit theoretisch<br />
ein weiterer Risikofaktor, zumindest bei einem Teil der Kinder mit orofazialen Spalten hinzu.<br />
Nun kann man nicht davon ausgehen, daß alle hier untersuchten Kinder eine familiäre<br />
Disposition für eine spezifische SES hatten. Das ist zumindest sehr unwahrscheinlich und<br />
anhand der Studienprotokolle ergibt sich auch keinerlei Hinweis darauf. Das ähnliche<br />
Störungsbild muß also eine andere Ursache haben. Hier bleiben viele Fragen unbeantwortet,<br />
aber die vorliegenden Ergebnisse könnten Ausgangspunkt für gezielte Studien zur Klärung<br />
dieser Frage sein. Grundsätzlich wäre anzuraten die familiäre Disposition für eine SSES bei<br />
den Säuglingen mit orofazialen Spalten mit zu erfassen. Streng genommen kann man aber das<br />
Mitwirken dieser Komponente bei den hier untersuchten Säuglingen mit orofazialen Spalten<br />
auch nicht gänzlich ausschließen, da die familiäre Disposition bisher nicht untersucht wurde.<br />
74