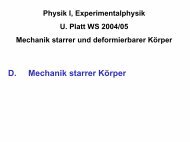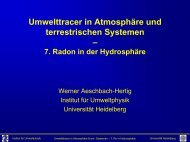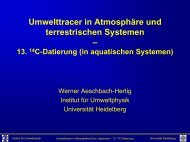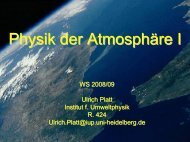Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität ...
Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität ...
Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
58 KAPITEL 3. PROBENAUFBEREITUNG FÜR EIS<br />
des Grenzgletschereises in Betracht, passen die gemessenen Werte gut zu den älteren Messungen<br />
von Friedrich (2003).<br />
Zur Abschätzung des Ursprungsgebiets der Eisproben kann man davon ausgehen, dass die<br />
gemessene Proben in einer Höhe von über 3800 m akkumuliert worden sein müssen, da in einer<br />
tieferen Lage kein kaltes Eis mehr entstehen kann. Auch der oberste Teil des Gletschers kann<br />
als Akkumulationsgebiet ausgeschlossen werden, da das von dort stammende Eis erst an Stellen,<br />
die tiefer als das Probenahmegebiet liegen, an die Oberfläche kommt (vgl. die Fließlinien in<br />
3.17 b). Eine realistische Annahme <strong>für</strong> das Ursprungsgebiet der Proben wären ca. 4000-4400 m<br />
Höhe. Martinerie et al. (1992) haben den Gasgehalt verschiedener Gletscher mit unterschiedlich<br />
hohen Akkumulationsgebieten gemessen. Bei der <strong>für</strong> die Grenzgletscherproben angenommenen<br />
Höhe sagen ihre Daten einen Gasgehalt von (0,080 ± 0,007) voraus (Abb. 3.18). Der gemessene<br />
Wert liegt leicht darunter. Möglicherweise blieben auch nach dem Überfrieren auf Aktivkohle<br />
im Schmelzwasser gelöste Gase zurück, was den gemessenen Gasgehalt senken würde. Eine<br />
weitere Fehlerquelle stellen beim Sägen an der Oberfläche geöffnete Blasen dar, deren Gas bei<br />
der Gasmessung nicht berücksichtigt wurde. Es könnten auch durch Sublimation des Eises beim<br />
Reinigungsprozess durch Abpumpen teilweise Blasen geöffnet worden sein.<br />
In Martinerie et al. (1992) wurde die Unsicherheit aufgr<strong>und</strong> möglicher Sublimation auf 0,5%<br />
geschätzt. Allerdings wurden dabei Proben von nur ca. 20 g gemessen, die ein ungünstigeres<br />
Verhältnis von Oberfläche zu Volumen haben. Die Verluste sollten also hier vernachlässigbar sein.<br />
Die Effekte möglicher beim Schneiden geöffneter Blasen wurde wie folgt abgeschätzt: Die Proben<br />
lagen in mehreren Stücken vor, deren Oberfläche etwa 600 (G1) bzw. 800 cm2 (G2) betrug.<br />
Nimmt man an, dass Blasen, die maximal 0,5 mm unter der Oberfläche liegen, geöffnet werden,<br />
kommt man auf 30 bzw. 40 cm3 Volumen, das eventuell betroffen ist. Setzt man den Gasgehalt<br />
ml ST P<br />
dieses Volumens in erster Näherung mit dem gemessenen Gasgehalt von (0,070 ± 0,004) g<br />
gleich, bekommt man bei einer Dichte von 0,89 gcm−3 einen Fehler von 2,2 ml ST P bzw.<br />
2,8 ml ST P . Berücksichtigt man diesen Verlust, so liegt der gemessene Gasgehalt in beiden<br />
Proben innerhalb der Vorhersagen von Martinerie et al. (1992).<br />
Argonseparation: Verlauf der Separation, Ausbeute <strong>und</strong> Reinheit<br />
Nach der Bestimmung des Gesamtgasgehaltes wurde das Argon bei beiden Proben separiert. Die<br />
Separation dauerte bei Probe G2 etwa 130 Minuten, wobei der Getter ca. 100 Minuten geheizt<br />
wurde. Die restliche Zeit war die Heizung ausgestellt, um den aus dem Titan ausdiff<strong>und</strong>ierten<br />
Wasserstoff wieder zu absorbieren. Bei Probe G1 wurde das Restgas sofort nach dem Abschalten<br />
der Heizung auf Aktivkohle geladen <strong>und</strong> an einem Quadrupol-Massenspektrometer auf seine<br />
Gaszusammensetzung gemessen, sodass sowohl die Verunreinigung durch Wasserstoff als auch<br />
die Qualität der Ar/N2- <strong>und</strong> Ar/O2-Separation überprüft werden konnte. Probe G2 wurde zur<br />
potentiellen 39 Ar-Messung aufgehoben.<br />
Der Verlauf des Getterprozessses (Abb. 3.20) unterscheidet sich nicht wesentlich von demjenigen<br />
der reinen Laborluft (Abb. 3.14-3.16). Schon nach 10 Minuten sind 78% des Gases separiert,<br />
nach 23 Minuten 92,7%. Nach 80 Minuten zeigte sich keine Veränderung im Druckverlauf mehr.<br />
Nach Abschalten der Heizung reduzierte sich der Druck innerhalb von 24 Minuten noch einmal<br />
um über 60% auf 0,9 mbar. Das Überfrieren des Restargons auf die Aktivkohlefalle geschah in<br />
weniger als 4 Minuten.<br />
Die Menge des gewonnenen Argons konnte leider nur ungenau bestimmt werden. Der Gr<strong>und</strong><br />
da<strong>für</strong> war die Ungenauigkeit des Druckmessgeräts sowie der große Temperaturgradient innerhalb