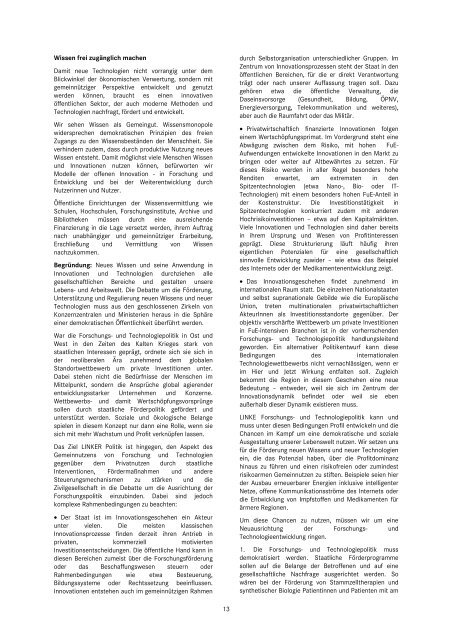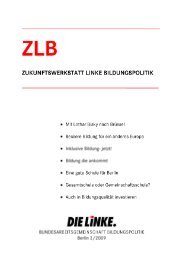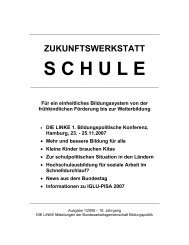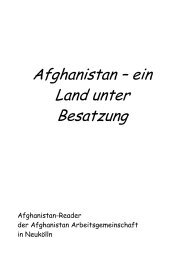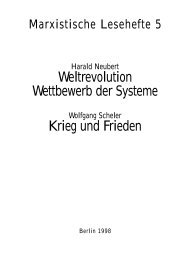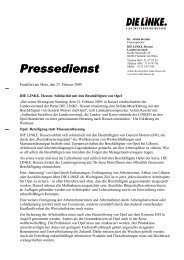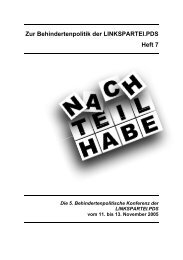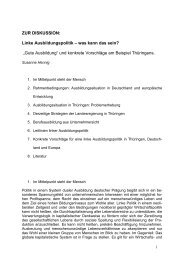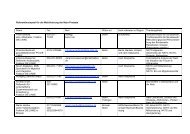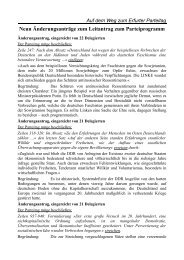Antragsheft 4 - Die Linke
Antragsheft 4 - Die Linke
Antragsheft 4 - Die Linke
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissen frei zugänglich machen<br />
Damit neue Technologien nicht vorrangig unter dem<br />
Blickwinkel der ökonomischen Verwertung, sondern mit<br />
gemeinnütziger Perspektive entwickelt und genutzt<br />
werden können, braucht es einen innovativen<br />
öffentlichen Sektor, der auch moderne Methoden und<br />
Technologien nachfragt, fördert und entwickelt.<br />
Wir sehen Wissen als Gemeingut. Wissensmonopole<br />
widersprechen demokratischen Prinzipien des freien<br />
Zugangs zu den Wissensbeständen der Menschheit. Sie<br />
verhindern zudem, dass durch produktive Nutzung neues<br />
Wissen entsteht. Damit möglichst viele Menschen Wissen<br />
und Innovationen nutzen können, befürworten wir<br />
Modelle der offenen Innovation - in Forschung und<br />
Entwicklung und bei der Weiterentwicklung durch<br />
Nutzerinnen und Nutzer.<br />
Öffentliche Einrichtungen der Wissensvermittlung wie<br />
Schulen, Hochschulen, Forschungsinstitute, Archive und<br />
Bibliotheken müssen durch eine ausreichende<br />
Finanzierung in die Lage versetzt werden, ihrem Auftrag<br />
nach unabhängiger und gemeinnütziger Erarbeitung,<br />
Erschließung und Vermittlung von Wissen<br />
nachzukommen.<br />
Begründung: Neues Wissen und seine Anwendung in<br />
Innovationen und Technologien durchziehen alle<br />
gesellschaftlichen Bereiche und gestalten unsere<br />
Lebens- und Arbeitswelt. <strong>Die</strong> Debatte um die Förderung,<br />
Unterstützung und Regulierung neuen Wissens und neuer<br />
Technologien muss aus den geschlossenen Zirkeln von<br />
Konzernzentralen und Ministerien heraus in die Sphäre<br />
einer demokratischen Öffentlichkeit überführt werden.<br />
War die Forschungs- und Technologiepolitik in Ost und<br />
West in den Zeiten des Kalten Krieges stark von<br />
staatlichen Interessen geprägt, ordnete sich sie sich in<br />
der neoliberalen Ära zunehmend dem globalen<br />
Standortwettbewerb um private Investitionen unter.<br />
Dabei stehen nicht die Bedürfnisse der Menschen im<br />
Mittelpunkt, sondern die Ansprüche global agierender<br />
entwicklungsstarker Unternehmen und Konzerne.<br />
Wettbewerbs- und damit Wertschöpfungsvorsprünge<br />
sollen durch staatliche Förderpolitik gefördert und<br />
unterstützt werden. Soziale und ökologische Belange<br />
spielen in diesem Konzept nur dann eine Rolle, wenn sie<br />
sich mit mehr Wachstum und Profit verknüpfen lassen.<br />
Das Ziel LINKER Politik ist hingegen, den Aspekt des<br />
Gemeinnutzens von Forschung und Technologien<br />
gegenüber dem Privatnutzen durch staatliche<br />
Interventionen, Fördermaßnahmen und andere<br />
Steuerungsmechanismen zu stärken und die<br />
Zivilgesellschaft in die Debatte um die Ausrichtung der<br />
Forschungspolitik einzubinden. Dabei sind jedoch<br />
komplexe Rahmenbedingungen zu beachten:<br />
• Der Staat ist im Innovationsgeschehen ein Akteur<br />
unter vielen. <strong>Die</strong> meisten klassischen<br />
Innovationsprozesse finden derzeit ihren Antrieb in<br />
privaten, kommerziell motivierten<br />
Investitionsentscheidungen. <strong>Die</strong> öffentliche Hand kann in<br />
diesen Bereichen zumeist über die Forschungsförderung<br />
oder das Beschaffungswesen steuern oder<br />
Rahmenbedingungen wie etwa Besteuerung,<br />
Bildungssysteme oder Rechtssetzung beeinflussen.<br />
Innovationen entstehen auch im gemeinnützigen Rahmen<br />
13<br />
durch Selbstorganisation unterschiedlicher Gruppen. Im<br />
Zentrum von Innovationsprozessen steht der Staat in den<br />
öffentlichen Bereichen, für die er direkt Verantwortung<br />
trägt oder nach unserer Auffassung tragen soll. Dazu<br />
gehören etwa die öffentliche Verwaltung, die<br />
Daseinsvorsorge (Gesundheit, Bildung, ÖPNV,<br />
Energieversorgung, Telekommunikation und weiteres),<br />
aber auch die Raumfahrt oder das Militär.<br />
• Privatwirtschaftlich finanzierte Innovationen folgen<br />
einem Wertschöpfungsprimat. Im Vordergrund steht eine<br />
Abwägung zwischen dem Risiko, mit hohen FuE-<br />
Aufwendungen entwickelte Innovationen in den Markt zu<br />
bringen oder weiter auf Altbewährtes zu setzen. Für<br />
dieses Risiko werden in aller Regel besonders hohe<br />
Renditen erwartet, am extremsten in den<br />
Spitzentechnologien (etwa Nano-, Bio- oder IT-<br />
Technologien) mit einem besonders hohen FuE-Anteil in<br />
der Kostenstruktur. <strong>Die</strong> Investitionstätigkeit in<br />
Spitzentechnologien konkurriert zudem mit anderen<br />
Hochrisikoinvestitionen – etwa auf den Kapitalmärkten.<br />
Viele Innovationen und Technologien sind daher bereits<br />
in ihrem Ursprung und Wesen von Profitinteressen<br />
geprägt. <strong>Die</strong>se Strukturierung läuft häufig ihren<br />
eigentlichen Potenzialen für eine gesellschaftlich<br />
sinnvolle Entwicklung zuwider – wie etwa das Beispiel<br />
des Internets oder der Medikamentenentwicklung zeigt.<br />
• Das Innovationsgeschehen findet zunehmend im<br />
internationalen Raum statt. <strong>Die</strong> einzelnen Nationalstaaten<br />
und selbst supranationale Gebilde wie die Europäische<br />
Union, treten multinationalen privatwirtschaftlichen<br />
AkteurInnen als Investitionsstandorte gegenüber. Der<br />
objektiv verschärfte Wettbewerb um private Investitionen<br />
in FuE-intensiven Branchen ist in der vorherrschenden<br />
Forschungs- und Technologiepolitik handlungsleitend<br />
geworden. Ein alternativer Politikentwurf kann diese<br />
Bedingungen des internationalen<br />
Technologiewettbewerbs nicht vernachlässigen, wenn er<br />
im Hier und Jetzt Wirkung entfalten soll. Zugleich<br />
bekommt die Region in diesem Geschehen eine neue<br />
Bedeutung – entweder, weil sie sich im Zentrum der<br />
Innovationsdynamik befindet oder weil sie eben<br />
außerhalb dieser Dynamik existieren muss.<br />
LINKE Forschungs- und Technologiepolitik kann und<br />
muss unter diesen Bedingungen Profil entwickeln und die<br />
Chancen im Kampf um eine demokratische und soziale<br />
Ausgestaltung unserer Lebenswelt nutzen. Wir setzen uns<br />
für die Förderung neuen Wissens und neuer Technologien<br />
ein, die das Potenzial haben, über die Profitdominanz<br />
hinaus zu führen und einen risikofreien oder zumindest<br />
risikoarmen Gemeinnutzen zu stiften. Beispiele seien hier<br />
der Ausbau erneuerbarer Energien inklusive intelligenter<br />
Netze, offene Kommunikationsströme des Internets oder<br />
die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten für<br />
ärmere Regionen.<br />
Um diese Chancen zu nutzen, müssen wir um eine<br />
Neuausrichtung der Forschungs- und<br />
Technologieentwicklung ringen.<br />
1. <strong>Die</strong> Forschungs- und Technologiepolitik muss<br />
demokratisiert werden. Staatliche Förderprogramme<br />
sollen auf die Belange der Betroffenen und auf eine<br />
gesellschaftliche Nachfrage ausgerichtet werden. So<br />
wären bei der Förderung von Stammzelltherapien und<br />
synthetischer Biologie Patientinnen und Patienten mit am