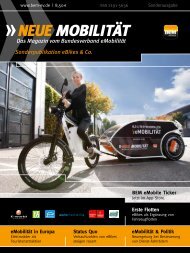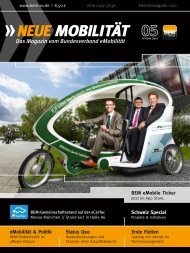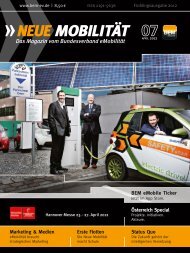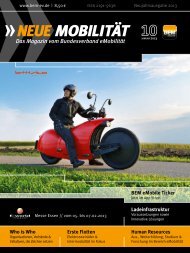NEUE MOBILITÄT 16
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Revolution der Zweiräder - GUNNAR FEHLAU<br />
Wenn wir die Neue Mobilität als eMobilität verstehen - was<br />
hier Tenor sein dürfte - dann sind die Menschen unterwegs<br />
und zwar auf dem Pedelec. Selbst konservativ geschätzt fahren<br />
in Deutschland rund 1,5 Mio. Pedelecs. Das ist eine beachtliche<br />
Zahl und erlaubt, marktschreierisch vom Pedelec<br />
als der führenden Individual-eMobilität zu sprechen. Die<br />
eAuto-Bestände in der Republik sind dagegen im absoluten<br />
und relativen Vergleich gegenwärtig allenfalls in homöopathischen<br />
Dosen auffindbar. Nimmt man die Hybridautos mit<br />
in die Wertung, so verändern sich die Zahlen, aber nicht die<br />
Aussage des Vergleichs. Daraus lässt sich weder der Niedergang<br />
des Automobils noch ein Siegeszug des Fahrrads/<br />
Pedelecs herauslesen. Es ist eine situative Bestandsaufnahme<br />
in einem Bereich, der mannigfaltigen Veränderungen unterworfen<br />
ist und damit von geringer prognostischer Kraft.<br />
QUELLE: www.pd-f.de / biketec<br />
Welche Bedürfnisse stehen hinter der Neuen Mobilität? Das<br />
»neu« streichen wir erst einmal. Hinter jeder Mobilität steht<br />
der Mangel. Das begann mit dem aufrechten Gang und Auszug<br />
aus Afrika und gilt auch für die abendliche Kneipentour oder<br />
die tägliche Fahrt zur Arbeit. Damit wird klar: Es gibt eine sehr<br />
archaische Bedürfnislage, die sich facettenreich ausgestaltet<br />
und eine ebenso grundsätzliche wie vielfältige Mobilität, die<br />
diese Mangelbedürfnisse zu beheben trachtet. Die Pferdekutsche<br />
ist fast weg, das eAuto noch nicht wirklich da, alles<br />
ist in Bewegung und im Wandel. Eigentlich nichts Neues und<br />
nichts Altes, sondern ein steter Wandel. Doch wie vollzieht<br />
sich der Wandel?<br />
Allen Unkenrufen zum Trotz gibt es nach wie vor Bücher, echte<br />
Konferenzen und auch handschriftliche Notizen. Über alle Lebensbereiche<br />
hinweg verläuft das Ränkespiel zwischen dem<br />
Neuen und dem Alten nach der gleichen Dramaturgie: Das Neue<br />
kommt aus der Nische, auf eine erste Ablehnung folgt ein zaghaftes<br />
Ausprobieren. Anschließend werden die partikularen<br />
Vorzüge zum Anlass genommen, um teils spielerisch, teils<br />
verkrampft das Neue in allen möglichen (und unmöglichen)<br />
Zusammenhängen auszuprobieren. Das ist eine herrliche<br />
Phase für den Beobachter, denn Erfolg und Misserfolg liegen<br />
eng beieinander und finden in unterschiedlichen Anwendungen<br />
mitunter vollständig parallel statt. Praktisch: Befürworter<br />
wie Gegner finden stets genug Munition für ihre Position.<br />
Dieser Zustand transformiert sich schließlich zu der Phase, in<br />
der das Neue die Aufgaben übernimmt, in denen es das Alte<br />
aussticht und das Alte bleibt bei dem, was es besser kann.<br />
Liebesbriefe wirken auf Papier einfach besser, während eine<br />
Bedienungsanleitung sich am Rechner einfach besser durchsuchen<br />
lässt.<br />
Die Dinge nehmen ihren Lauf und halten Richtung und Tempo<br />
auf ewig, wenn sie keinen neuen Impuls erhalten. So hat es<br />
Isaac Newton frei ausgelegt formuliert. Das gilt auch für den<br />
Wandel der Mobilität. So flüssig, wie gerade dargestellt, ist<br />
das Wechselspiel von Neu und Alt im laufenden Betrieb jedoch<br />
nicht immer. Statt Ewigkeit gibt es laufend neue Impulse<br />
und die Wirkrichtung und -intensität ändert sich. Da müssen<br />
dann schon mal die Grundeinstellungen nachjustiert werden:<br />
Im zähen Ringen über die beste Energiequelle verändern<br />
sich durch einen unfallbedingten Adhoc-Atomausstieg die<br />
Grundannahmen. Oder gesellschaftlicher Wandel ändert die<br />
Grundhaltung zu Verhaltensweisen oder Dingen aus einer<br />
Subkultur heraus grundsätzlich. Vor einigen Jahren noch waren<br />
Veganer »Spinner«, heute sind sie hip. Vor Jahren noch<br />
waren Radtouristen in Hotels und Gastronomie unbeliebt,<br />
heute hofiert man sie, weil sie stattlichen Umsatz bedeuten.<br />
Schauen wir auf den Firmenparkplatz: Früher kam mit dem<br />
Rad, wer Öko-Fundi war, sich keinen Wagen leisten konnte<br />
oder den Lappen dem Alkohol geopfert hatte. Heute erkennen<br />
wir Radfahrer als schneller, ökologischer und cleverer:<br />
Sie verbinden alltägliche Mobilitätspflichten mit Spaß. Und<br />
die Betriebsärzte frohlocken: Radfahrer sind seltener krank<br />
und am Arbeitsplatz von der ersten Minute an wach.<br />
Der Erfolg des Pedelecs, im letzten Jahr allein<br />
wurden über 400.000 Stück verkauft, ist zunächst<br />
einmal kein Erfolg einer Branche oder planvoller<br />
Politik. Im Gegenteil: Das Pedelec ist trotz<br />
und nicht wegen dieser beiden ein Erfolg.<br />
Das gilt auch für die Politik: Es waren keine politischen Maßnahmen,<br />
die das Pedelec erfolgreich gemacht haben, vielmehr<br />
zeigte sich das Pedelec schlicht resistenter gegen die Auswirkungen<br />
politischer Aktivitäten als andere (neue) Formen der<br />
Mobilität. Branche und Politik wurden vom Erfolg der Elektrifizierung<br />
des Fahrrades überrascht. Die Akklimatisierung an<br />
diesen hält in beiden System noch an. Die Fahrradbranche<br />
kann (dennoch) stolz auf sich sein und verdient Respekt für<br />
ihre Leistungen und den Erfolg des Pedelec. Umgekehrt muss<br />
44 Neue Mobilität