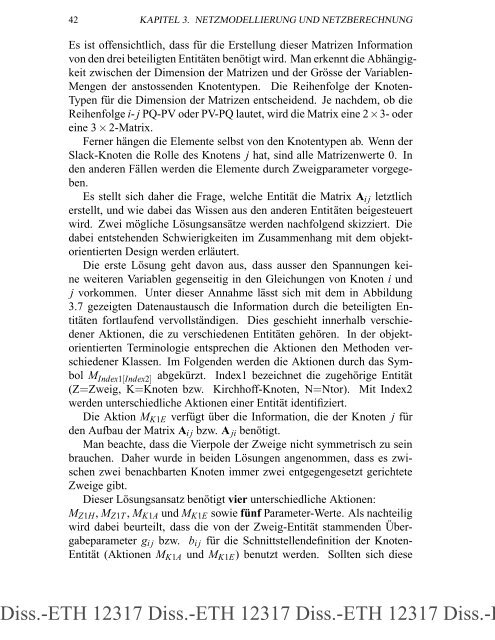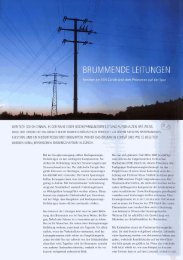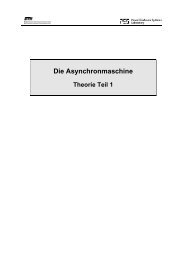Diss.-ETH 12317 Diss.-ETH 12317 Diss.-ETH 12317 Diss.-E Eine ...
Diss.-ETH 12317 Diss.-ETH 12317 Diss.-ETH 12317 Diss.-E Eine ...
Diss.-ETH 12317 Diss.-ETH 12317 Diss.-ETH 12317 Diss.-E Eine ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
42 KAPITEL 3. NETZMODELLIERUNG UND NETZBERECHNUNG<br />
Es ist offensichtlich, dass für die Erstellung dieser Matrizen Information<br />
von den drei beteiligten Entitäten benötigt wird. Man erkennt die Abhängigkeit<br />
zwischen der Dimension der Matrizen und der Grösse der Variablen-<br />
Mengen der anstossenden Knotentypen. Die Reihenfolge der Knoten-<br />
Typen für die Dimension der Matrizen entscheidend. Je nachdem, ob die<br />
Reihenfolge i- j PQ-PV oder PV-PQ lautet, wird die Matrix eine 2×3- oder<br />
eine 3 × 2-Matrix.<br />
Ferner hängen die Elemente selbst von den Knotentypen ab. Wenn der<br />
Slack-Knoten die Rolle des Knotens j hat, sind alle Matrizenwerte 0. In<br />
den anderen Fällen werden die Elemente durch Zweigparameter vorgegeben.<br />
Es stellt sich daher die Frage, welche Entität die Matrix Aij letztlich<br />
erstellt, und wie dabei das Wissen aus den anderen Entitäten beigesteuert<br />
wird. Zwei mögliche Lösungsansätze werden nachfolgend skizziert. Die<br />
dabei entstehenden Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem objektorientierten<br />
Design werden erläutert.<br />
Die erste Lösung geht davon aus, dass ausser den Spannungen keine<br />
weiteren Variablen gegenseitig in den Gleichungen von Knoten i und<br />
j vorkommen. Unter dieser Annahme lässt sich mit dem in Abbildung<br />
3.7 gezeigten Datenaustausch die Information durch die beteiligten Entitäten<br />
fortlaufend vervollständigen. Dies geschieht innerhalb verschiedener<br />
Aktionen, die zu verschiedenen Entitäten gehören. In der objektorientierten<br />
Terminologie entsprechen die Aktionen den Methoden verschiedener<br />
Klassen. Im Folgenden werden die Aktionen durch das Symbol<br />
M Index1[Index2] abgekürzt. Index1 bezeichnet die zugehörige Entität<br />
(Z=Zweig, K=Knoten bzw. Kirchhoff-Knoten, N=Ntor). Mit Index2<br />
werden unterschiedliche Aktionen einer Entität identifiziert.<br />
Die Aktion MK1E verfügt über die Information, die der Knoten j für<br />
den Aufbau der Matrix Aij bzw. A ji benötigt.<br />
Man beachte, dass die Vierpole der Zweige nicht symmetrisch zu sein<br />
brauchen. Daher wurde in beiden Lösungen angenommen, dass es zwischen<br />
zwei benachbarten Knoten immer zwei entgegengesetzt gerichtete<br />
Zweige gibt.<br />
Dieser Lösungsansatz benötigt vier unterschiedliche Aktionen:<br />
MZ1H, MZ1T , MK1A und MK1E sowie fünf Parameter-Werte. Als nachteilig<br />
wird dabei beurteilt, dass die von der Zweig-Entität stammenden Übergabeparameter<br />
gij bzw. bij für die Schnittstellendefinition der Knoten-<br />
Entität (Aktionen MK1A und MK1E) benutzt werden. Sollten sich diese<br />
<strong>Diss</strong>.-<strong>ETH</strong> <strong>12317</strong> <strong>Diss</strong>.-<strong>ETH</strong> <strong>12317</strong> <strong>Diss</strong>.-<strong>ETH</strong> <strong>12317</strong> <strong>Diss</strong>.-E