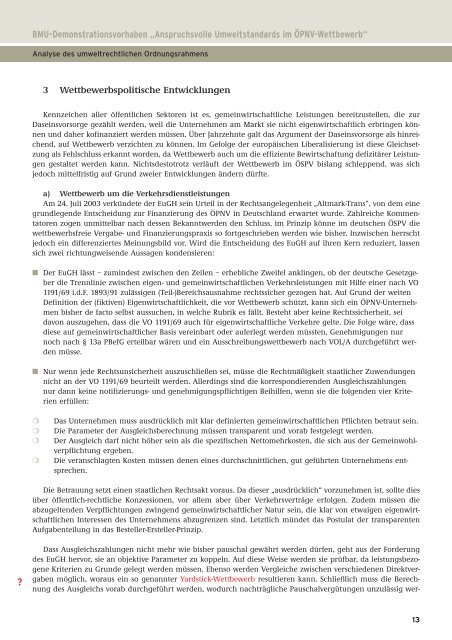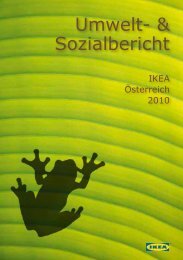UMWELTPOLITIK - Eltis
UMWELTPOLITIK - Eltis
UMWELTPOLITIK - Eltis
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
?<br />
BMU-Demonstrationsvorhaben „Anspruchsvolle Umweltstandards im ÖPNV-Wettbewerb“<br />
Analyse des umweltrechtlichen Ordnungsrahmens<br />
3 Wettbewerbspolitische Entwicklungen<br />
Kennzeichen aller öffentlichen Sektoren ist es, gemeinwirtschaftliche Leistungen bereitzustellen, die zur<br />
Daseinsvorsorge gezählt werden, weil die Unternehmen am Markt sie nicht eigenwirtschaftlich erbringen können<br />
und daher kofinanziert werden müssen. Über Jahrzehnte galt das Argument der Daseinsvorsorge als hinreichend,<br />
auf Wettbewerb verzichten zu können. Im Gefolge der europäischen Liberalisierung ist diese Gleichsetzung<br />
als Fehlschluss erkannt worden, da Wettbewerb auch um die effiziente Bewirtschaftung defizitärer Leistungen<br />
gestaltet werden kann. Nichtsdestotrotz verläuft der Wettbewerb im ÖSPV bislang schleppend, was sich<br />
jedoch mittelfristig auf Grund zweier Entwicklungen ändern dürfte.<br />
a) Wettbewerb um die Verkehrsdienstleistungen<br />
Am 24. Juli 2003 verkündete der EuGH sein Urteil in der Rechtsangelegenheit „Altmark-Trans“, von dem eine<br />
grundlegende Entscheidung zur Finanzierung des ÖPNV in Deutschland erwartet wurde. Zahlreiche Kommentatoren<br />
zogen unmittelbar nach dessen Bekanntwerden den Schluss, im Prinzip könne im deutschen ÖSPV die<br />
wettbewerbsfreie Vergabe- und Finanzierungspraxis so fortgeschrieben werden wie bisher. Inzwischen herrscht<br />
jedoch ein differenziertes Meinungsbild vor. Wird die Entscheidung des EuGH auf ihren Kern reduziert, lassen<br />
sich zwei richtungweisende Aussagen kondensieren:<br />
■ Der EuGH lässt – zumindest zwischen den Zeilen – erhebliche Zweifel anklingen, ob der deutsche Gesetzgeber<br />
die Trennlinie zwischen eigen- und gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen mit Hilfe einer nach VO<br />
1191/69 i.d.F. 1893/91 zulässigen (Teil-)Bereichsausnahme rechtssicher gezogen hat. Auf Grund der weiten<br />
Definition der (fiktiven) Eigenwirtschaftlichkeit, die vor Wettbewerb schützt, kann sich ein ÖPNV-Unternehmen<br />
bisher de facto selbst aussuchen, in welche Rubrik es fällt. Besteht aber keine Rechtssicherheit, sei<br />
davon auszugehen, dass die VO 1191/69 auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelte. Die Folge wäre, dass<br />
diese auf gemeinwirtschaftlicher Basis vereinbart oder auferlegt werden müssten, Genehmigungen nur<br />
noch nach § 13a PBefG erteilbar wären und ein Ausschreibungswettbewerb nach VOL/A durchgeführt werden<br />
müsse.<br />
■ Nur wenn jede Rechtsunsicherheit auszuschließen sei, müsse die Rechtmäßigkeit staatlicher Zuwendungen<br />
nicht an der VO 1191/69 beurteilt werden. Allerdings sind die korrespondierenden Ausgleichszahlungen<br />
nur dann keine notifizierungs- und genehmigungspflichtigen Beihilfen, wenn sie die folgenden vier Kriterien<br />
erfüllen:<br />
❍ Das Unternehmen muss ausdrücklich mit klar definierten gemeinwirtschaftlichen Pflichten betraut sein.<br />
❍ Die Parameter der Ausgleichsberechnung müssen transparent und vorab festgelegt werden.<br />
❍ Der Ausgleich darf nicht höher sein als die spezifischen Nettomehrkosten, die sich aus der Gemeinwohlverpflichtung<br />
ergeben.<br />
❍ Die veranschlagten Kosten müssen denen eines durchschnittlichen, gut geführten Unternehmens entsprechen.<br />
Die Betrauung setzt einen staatlichen Rechtsakt voraus. Da dieser „ausdrücklich“ vorzunehmen ist, sollte dies<br />
über öffentlich-rechtliche Konzessionen, vor allem aber über Verkehrsverträge erfolgen. Zudem müssen die<br />
abzugeltenden Verpflichtungen zwingend gemeinwirtschaftlicher Natur sein, die klar von etwaigen eigenwirtschaftlichen<br />
Interessen des Unternehmens abzugrenzen sind. Letztlich mündet das Postulat der transparenten<br />
Aufgabenteilung in das Besteller-Ersteller-Prinzip.<br />
Dass Ausgleichszahlungen nicht mehr wie bisher pauschal gewährt werden dürfen, geht aus der Forderung<br />
des EuGH hervor, sie an objektive Parameter zu koppeln. Auf diese Weise werden sie prüfbar, da leistungsbezogene<br />
Kriterien zu Grunde gelegt werden müssen. Ebenso werden Vergleiche zwischen verschiedenen Direktvergaben<br />
möglich, woraus ein so genannter Yardstick-Wettbewerb resultieren kann. Schließlich muss die Berechnung<br />
des Ausgleichs vorab durchgeführt werden, wodurch nachträgliche Pauschalvergütungen unzulässig wer-<br />
13