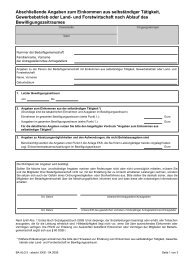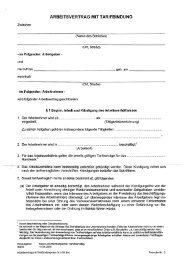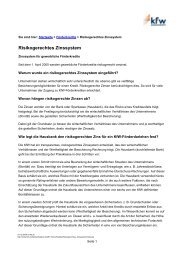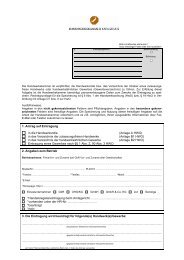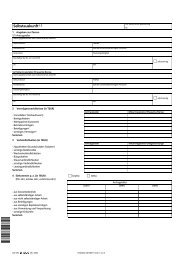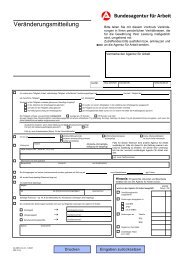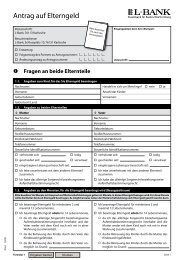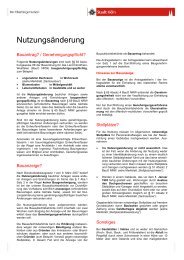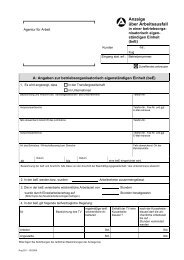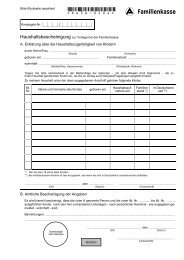Unternehmensnachfolge - Handwerkskammer Aachen
Unternehmensnachfolge - Handwerkskammer Aachen
Unternehmensnachfolge - Handwerkskammer Aachen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
71<br />
basis aus. Diese lässt sich über verschiedene Wege<br />
ermitteln:<br />
Vergleichswertverfahren:<br />
„Was kosten die anderen?“<br />
In Branchen, in denen Unternehmensübertragungen<br />
vergleichbarer Unternehmen häufig sind,<br />
z. B. freiberufliche Praxen, Gastronomie-Betriebe,<br />
Brauereien, Reinigungen usw. werden als Verhandlungsbasis<br />
meist die Preise bisheriger Transaktionen<br />
herangezogen. Die Daten werden dabei von<br />
branchengleichen Unternehmen herangezogen, die<br />
ähnliche oder fast deckungsgleiche Kennziffern aufweisen,<br />
u. a. hinsichtlich<br />
3 Unternehmensgröße<br />
3 Zusammensetzung der Vermögensbestandteile<br />
und der Kapitalstruktur<br />
3 Rechtsform<br />
3 Kundenstruktur bzw. Lieferantenkreis<br />
3 Qualifikation und Gehaltsniveau der Mitarbeiter<br />
3 Diversifikationsgrad<br />
3 potenzieller Käuferkreis<br />
3 Region.<br />
Je nach Branche werden zum Teil auch nur<br />
wenige oder Teilgrößen genutzt, die in dem jeweiligen<br />
Markt als besonders dominant oder stabil angesehen<br />
werden. Dazu zählen beispielsweise mengenmäßige<br />
Angaben wie Hektoliter, Quadratmeter,<br />
Konzessionen, Filialen usw. oder auch geldwerte<br />
Bezugsgrößen wie Umsatz oder Rohgewinn. Die<br />
Daten können über die entsprechenden Verbände,<br />
Kammern oder spezialisierte Unternehmensberater<br />
ermittelt werden. Vor allem bei kleinen und mittleren<br />
Unternehmen ist die Preisermittlung über<br />
Vergleichsdaten üblich.<br />
Ertragswertmethode:<br />
„Wie viel Gewinn erwirtschaftet das<br />
Unternehmen in Zukunft?“<br />
Wer ein Unternehmen kauft, investiert eine hohe<br />
Summe Geld in der Hoffnung, dass sich diese<br />
Investition auch lohnt und das Unternehmen entsprechend<br />
hohe Gewinne erzielt. Alternativ könnte man<br />
auch überlegen, das Geld in gut verzinsten<br />
Wertpapieren anzulegen. Wie ein Wertpapier muss<br />
daher auch der investierte Kaufpreis genügend<br />
Zinsen in Form des zukünftig erwirtschafteten<br />
Gewinns abwerfen. Die Kernfrage ist daher:<br />
Wie hoch darf der Kaufpreis sein, damit der erwirtschaftete<br />
Gewinn eine angemessene Verzinsung darstellt?<br />
Entscheidend ist also die zukünftige<br />
Ertragskraft (i.d.R. für die folgenden fünf Jahre) einer<br />
Unternehmung, damit der Nachfolger aus den<br />
Erträgen nicht nur die im Unternehmen erforderlichen<br />
Investitionen, sondern auch seine Zins- und<br />
Tilgungszahlungen (Kapitaldienst) aus dem Kauf der<br />
Unternehmung finanzieren kann.<br />
Der Ertragswert setzt sich zusammen<br />
3 aus den geschätzten zukünftigen Erträgen der<br />
folgenden fünf Jahre und<br />
3 dem so genannten Kapitalisierungszinsfuß, mit<br />
dem die geschätzten Erträge abgezinst werden.<br />
Die Schätzung der zukünftigen Erträge beruht<br />
auf den Betriebsergebnissen der vergangenen drei<br />
Jahre und wird – vereinfacht – folgendermaßen<br />
berechnet:<br />
Betriebsergebnisse der letzten drei Jahre<br />
./. kalkulatorischer Unternehmerlohn<br />
./. außerordentliche Erträge<br />
(Zuschüsse, nicht abzugsfähige<br />
Betriebsausgaben)<br />
+ außerordentliche Aufwendungen<br />
(Sonderabschreibungen, Spenden)<br />
= Durchschnittliches Betriebsergebnis<br />
Die geschätzten zukünftigen Erträge werden<br />
dann mit dem Kapitalisierungszinsfuß abgezinst.<br />
Hierbei handelt es sich um einen Zinssatz für risikolose<br />
Kapitalanlagen, wie beispielsweise deutsche<br />
Bundesanleihen plus einem Aufschlag für das<br />
Unternehmerrisiko. In der Rechtssprechung schwanken<br />
die Zinssätze zwischen fünf und zwölf Prozent.<br />
Im konkreten Fall hängt die Höhe von der jeweiligen<br />
Risikobeurteilung, der Annahme über künftige<br />
Geldentwertung und Refinanzierungsmöglichkeiten<br />
des Käufers ab. Der Aufschlag für das Unternehmerrisiko<br />
liegt etwa zwischen 5/10 und 30/10 des Basiszinses.<br />
Informationen und Hilfestellung hierzu bieten<br />
Wirtschaftsprüfer. Darüber hinaus können Sie mit<br />
Hilfe der unter www.nexxt.org angebotenen Online-<br />
Programme „Nachfolgeplaner“ die Unternehmenswerte<br />
nach einigen der verschiedenen Verfahren<br />
berechnen.