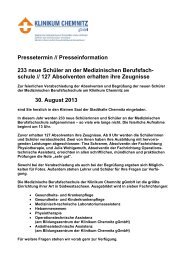Klinoskop 3/2010 - Klinikum Chemnitz
Klinoskop 3/2010 - Klinikum Chemnitz
Klinoskop 3/2010 - Klinikum Chemnitz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Generation zwischen<br />
den Kriegen<br />
Beschrieben wird die Generation zwischen<br />
zwei Kriegen im Inflationsjahr 1923. Den<br />
Menschen steckt das Elend der Kriegsfolgen<br />
noch in den Knochen, und die Gesellschaft<br />
befindet sich in einer moralischen<br />
Auflösung. Unter diesen äußeren Umständen<br />
versucht der 25jährige Ludwig Bodmer, sich<br />
als Kriegsheimkehrer und somit als Teil der<br />
„verlorenen Generation“ wieder in die Gesellschaft<br />
einzugliedern. Nachdem er seinen<br />
Beruf als Lehrer aufgegeben hat, weil er den<br />
Schülern Dinge beibringen musste, an die er<br />
selbst nicht mehr glaubte, arbeitet er in einer<br />
Grabsteinfirma, die seinem Kameraden Georg<br />
Kroll gehört. Gemeinsam mit seinen alten<br />
Kameraden versucht er, die im Ersten Weltkrieg<br />
verlorene Jugend nachzuholen, denn<br />
bürgerliche Begriffe haben sie schon längst<br />
verloren und frönen eher dem Alkohol und<br />
dem Vergnügen.<br />
Nebenbei jobbt er als Organist in einer Irrenanstalt.<br />
Dort lernt Bodmer auch die schöne<br />
Genevieve Terhoven kennen und lieben.<br />
Suche nach höherer Wahrheit<br />
Sie leidet an Schizophrenie und nennt sich<br />
deshalb selbst Isabelle. Ihr Leben in einer<br />
irrationalen Zweitwelt, gespalten durch ein<br />
traumatisches Erlebnis mit der Mutter, fasziniert<br />
Bodmer, und so verbringen die beiden<br />
viel Zeit bei Gesprächen über den Sinn des<br />
Lebens, ständig auf der Suche nach einer höheren<br />
Wahrheit.<br />
Das zentrale Symbol des Romans, der Grabstein<br />
in Form eines schwarzen Obelisken,<br />
zeigt also nicht nur in Bezug auf die erzählte<br />
Zeit als warnender Finger in den Himmel.<br />
Vielmehr ist er der Zeigefinger in Form einer<br />
Rakete und weist damit auf den Wahnsinn<br />
Mein Lieblingsbuch<br />
Erich Maria Remarque – Der schwarze Obelisk<br />
Roman einer verspäteten Jugend<br />
Ich hab’ es bestimmt dreimal gelesen. Oft auch wiederholt noch mal die mir besonders<br />
wichtigen Abschnitte. Gerade jetzt: Krise. Wirtschaftlich-finanziell – aber eben nicht nur. „Der<br />
schwarze Obelisik“ spielt in Zeiten der Krise und der Hyperinflation zwischen den beiden Weltkriegen<br />
des letzten Jahrhunderts und in der Sinnkrise im Leben des jungen Ludwig Bodmer<br />
– autobiografische Elemente aus dem Leben Remarques sind hier verstärkt eingeflossen.<br />
Das Phänomen der Heimkehrer<br />
Der schwarze Obelisk beschäftigt sich mit dem Phänomen der Heimkehrer aus dem Ersten<br />
Weltkrieg, aber da er erst 1956 erschien, ist es zugleich ein Roman über die Ursachen und<br />
das Erstarken des Nationalsozialismus. In der vor dem Hintergrund der Hyperinflation von<br />
1923 spielenden Handlung werden verschiedene Reaktionen auf den gerade erst vergangenen<br />
Krieg und damit auch verschiedene Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt.<br />
der Aufrüstung in den fünfziger Jahren hin.<br />
Auch der Prolog des Romans beschreibt den<br />
aktuellen Zustand der Gesellschaft um 1955<br />
und beinhaltet eine Mitteilung für den Leser,<br />
so dass dieser schon von vornherein weiß, wie<br />
er das Folgende zu lesen und einzuordnen hat.<br />
Nicht nur die Warnung vor atomarer und militärischer<br />
Konfrontation während des kalten<br />
Krieges sondern auch, wie ich finde, ganz aktuelle<br />
Themen, wie der Zerfall humanistischer<br />
Werte und die Sinnlosigkeit des Profitstrebens,<br />
werden in diesem Roman an der Situation<br />
während dieser Krise und Hyperinflation vortrefflich<br />
beschrieben.<br />
Ironie und Sarkasmus<br />
Remarque spart sich dabei sprachliche, stilistische<br />
und formale Experimente und konzentriert<br />
sich auf das Wesentliche: Die Darstellung<br />
der Zeit und die Vermittlung von gesellschaftlichen<br />
politischen Inhalten. So werden in Remarques<br />
Roman die politische Aussage und<br />
das Philosophieren über das Leben verknüpft<br />
zu einem Appell an die Humanität des Einzelnen.<br />
Mit viel Ironie und Sarkasmus kritisiert<br />
Remarque die Unbelehrbarkeit der Deutschen,<br />
sowohl in den zwanziger, als auch in den fünfziger<br />
Jahren. Die plötzliche Umwertung aller<br />
Werte in den Zwanzigern ähnelte der Lebensgier<br />
der Menschen in den Fünfzigern und ist<br />
auch heute noch aktuell, so dass Remarque<br />
mit „Der schwarze Obelisk“ ein literarisches<br />
Denkmal gegen das Vergessen gesetzt hat.<br />
Aus Geschehenem soll seiner Meinung nach<br />
gelernt werden, damit die gleichen Fehler<br />
nicht wieder und wieder geschehen.<br />
Verneigung vor dem Autor<br />
Mit dieser kurzen Rezension möchte ich mich<br />
nicht nur vor einem meiner Lieblingsschriftsteller<br />
verneigen, sondern auch vor einem<br />
aufrechten Deutschen. Einem Weltbürger aber<br />
auch, der unmittelbar mit der Machtergreifung<br />
der Nazis aus seiner Heimat fliehen musste,<br />
dessen Bücher 1933 auf dem ideologischen<br />
Scheiterhaufen der Nazis brannten und der<br />
immer, auch aus dem Exil heraus, gleichgesinnte<br />
gefährdete Zeitgenossen – still und<br />
bescheiden im Hintergrund agierend – unterstützte.<br />
Er versuchte Deutschland bei der Aufarbeitung<br />
der Naziherrschaft zu unterstützen,<br />
wenngleich man in der alten Bundesrepublik<br />
sehr lange brauchte, um ihn aus der Ecke<br />
des „Nestbeschmutzers“ („Im Westen nichts<br />
Neues“, „Zeit zu leben, Zeit zu sterben“, „Der<br />
Funke Leben“) herauszuholen. Das Remarque-<br />
Archiv, die Stiftung und das Museum in seiner<br />
Geburtsstadt Osnabrück, leisten für die Aufarbeitung<br />
und Verbreitung des literarisch geistigen<br />
Nachlasses von Erich Maria Remarque<br />
heute einen hervorragenden Beitrag.<br />
Im Westen nichts Neues<br />
„Im Westen nichts Neues“ war lange Zeit das<br />
meistübersetzte deutsche Buch und wurde<br />
wie viele andere Remarque-Bücher mehrfach<br />
verfilmt. Remarque hat in all seinen Werken<br />
immer den Menschen in Grenzsituationen beschrieben<br />
und die Humanität des Einzelnen<br />
sowie die Freiheit des Individuums als höchstes<br />
Gut hervorgehoben. Trotz aller Konflikte in<br />
allen Zeiten der menschlichen Gesellschaft<br />
muss man diese Sichtweise immer wieder<br />
dick unterstreichen.<br />
Ludwig Heinze<br />
Verwaltungsleiter Geriatriezentrum<br />
Sie möchten Ihr Lieblingsbuch im <strong>Klinoskop</strong><br />
den Kollegen und Lesern vorstellen?<br />
Wir freuen uns auf Ihren Vorschlag, den Sie<br />
bitte unkompliziert an die Redaktionsadresse<br />
mailen.<br />
K a l e i d o s k o p<br />
91





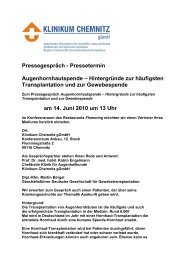



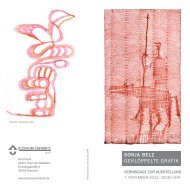




![Programm Einladung Chemnitz 13 aktuell - [Kompatibilitätsmodus]](https://img.yumpu.com/23879697/1/184x260/programm-einladung-chemnitz-13-aktuell-kompatibilitatsmodus.jpg?quality=85)