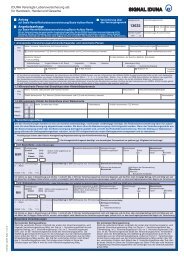KV-Handbuch 2011 - SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG
KV-Handbuch 2011 - SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG
KV-Handbuch 2011 - SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>KV</strong>-Lexikon (wichtige Fachbegriffe von A bis Z)<br />
Festbetrag<br />
Gilt für die Leistungen der G<strong>KV</strong> wie z. B. Heil- und Hilfsmittel,<br />
Arzneien sowie Brillengläser. Wo mehrere therapeutisch gleichwertige<br />
Arzneimittel mit unterschiedlichen Preisangeboten verkauft<br />
werden, begrenzt der Festbetrag die Leistung der Kasse.<br />
Firmenwagen<br />
Ein Dienst-/Firmenwagen als Überlassung zur privaten Nutzung<br />
ist geldwerter Vorteil und stellt mithin steuer- und sozialversicherungspflichtiges<br />
Entgelt dar [§ 8 Abs. EStG, R 8.1 Abs.9<br />
LStR].<br />
Es gibt zwei Methoden, diesen geldwerten Vorteil zu ermitteln:<br />
1. Führung eines Fahrtenbuches<br />
Hierbei werden sämtliche Kosten für den Firmenwagen aufgeführt<br />
und auch jede Fahrt dokumentiert. Das Entgelt ermittelt<br />
sich dann wie folgt: (Gesamtkosten x Privat-km) / Gesamt-km<br />
2. Anwendung der 1%-Regelung<br />
Hier sind keine Nachweise erforderlich. Das Entgelt wird pauschal<br />
für jeden Monat mit 1% des Bruttolistenpreises (zzgl etwaiger<br />
Sonderausstattungen) im Zeitpunkt der Erstzulassung<br />
ermittelt. Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte<br />
sieht § 8 Abs. 2 EStG eine am Bruttolistenpreis orientierte pauschale<br />
Ermittlung vor. Der geldwerte Vorteil wird für jeden<br />
Monat und Entfernungskilometer (einfache Entfernung) mit<br />
0,03% des Listenpreises angesetzt. Diese beiden geldwerten<br />
Vorteile sind dann zu addieren.<br />
Der geldwerte Vorteil für einen Firmenwagen wird ebenfalls bei<br />
der Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts berücksichtigt,<br />
um zu prüfen, ob jemand als Arbeitnehmer nach § 6<br />
SGB V versicherungsfrei wird.<br />
Freie Heilfürsorge<br />
Die Heilfürsorge ist eine besondere Form der Fürsorgepflicht<br />
des Dienstherrn gegenüber seinen Beamten. Sie wird in der<br />
Regel den Beamten gewährt, die während der Ausübung ihres<br />
Dienstes besonderen Gefahren ausgesetzt sind (Polizeibeamte,<br />
Soldaten, zum Teil Feuerwehrleute). Die freie Heilfürsorge übernimmt<br />
in der Regel für den Beamten 100 % der erstattungsfähigen<br />
Krankheitskosten.<br />
Die Heilfürsorge deckt jedoch nicht alle entstehenden Krankheits<br />
kosten ab (z. B. je nach Vorschrift Lücken im ambulanten<br />
Bereich für Zahnersatz, Sehhilfen, Heilpraktiker und außerhalb<br />
der Bundeswehr/ Bundespolizei keine komplette Übernahme<br />
des Zweibettzimmers und der privatärztlichen Behandlung).<br />
Je nach geltender Heilfürsorgevorschrift erlischt der Anspruch<br />
auf freie Heilfürsorge nach Ende der Ausbildung oder Ausscheiden<br />
aus dem aktiven Dienst. Ab diesem Zeitpunkt haben<br />
diese Beamten Anspruch auf Beihilfe (siehe auch Anwartschaftsversicherung).<br />
In Hessen, Niedersachsen bei Dienstantritt<br />
nach 01.99, Rheinland-Pfalz und Saarland haben Polizeibeamte<br />
auch in der Ausbildung einen Beihilfeanspruch, also<br />
keine freie Heilfürsorge.<br />
Für berücksichtigungsfähige Ehegatten und Kinder besteht<br />
Anspruch auf Beihilfe entsprechend der jeweiligen Beihilfevorschrift<br />
(hier kommt die Restkostenabsicherung über aktive<br />
Beihilfetarife infrage).<br />
Während des Anspruchs auf Heilfürsorge besteht keine Versicherungspflicht<br />
in der P<strong>KV</strong>. Endet die Heilfürsorge, entsteht zu<br />
diesem Zeitpunkt die Verpflichtung, eine beihilfekonforme private<br />
Krankenversicherung abzuschließen. Damit eine Versicherung<br />
im Beihilfe-Basistarif verhindert werden kann, ist in jedem<br />
Fall der rechtzeitige Abschluss einer Anwartschaftsversicherung<br />
auf <strong>SIGNAL</strong> Tarife zu empfehlen. Nur diese sichern dann<br />
den Zugang in leistungsstarke Beihilfetarife.<br />
Freiwillige Versicherung<br />
Eigentlich: „freiwillige Weiterversicherung“. Wer einer gesetzlichen<br />
Kasse weiterhin angehören möchte, weil z. B. die Pflichtversicherung<br />
endet, kann sich freiwillig weiterversichern. Die<br />
freiwillige Versicherung muss innerhalb von 3 Monaten nach<br />
dem Ende der vorangegangenen Pflichtmitgliedschaft angezeigt<br />
werden. Es ist die Erfüllung einer Vorversicherungszeit<br />
erforderlich: entweder unmittelbar vorher 12 Monate bzw. in den<br />
letzten 5 Jahren mindestens 24 Monate G<strong>KV</strong>-versichert (Achtung:<br />
ein freiwilliger Beitritt, z. B. nach einer bestehenden P<strong>KV</strong>-<br />
Vollversicherung ist nicht möglich). Seit dem 01.01.2000 ist die<br />
genannte Vorversicherungszeit auch für die freiwillige<br />
Weiterver siche rung im Anschluss an eine Familienversicherung<br />
erforderlich.<br />
Freiwillige Versicherung, Beitragsbemessung<br />
Die Grundsätze zur Beitragsbemessung von freiwillig Versicherten<br />
(§ 240 SGB V) legt jetzt einheitlich für alle Krankenkassen<br />
der Spitzenverband Bund fest. Bei der Beitragsbemessung<br />
freiwillig Versicherter ist grundsätzlich die gesamte Leistungsfähigkeit<br />
heranzuziehen.<br />
Beitrag für freiwillig Versicherte, falls Ehepartner P<strong>KV</strong>-versichert<br />
Die beitragspflichtigen Einnahmen setzen sich aus den eigenen<br />
Einnahmen und den Einnahmen des P<strong>KV</strong>-versicherten Ehepartners<br />
zusammen. Für jedes unterhaltsberechtige Kind, für<br />
das gemäß § 10 Abs. 3 SGB V (siehe Seite 116) eine<br />
Familien versicherung in der G<strong>KV</strong> nicht möglich ist, gilt folgendes:<br />
Von den Einnahmen des P<strong>KV</strong>-versicherten Ehepartners ist<br />
ein Betrag von 1/3 der monatlichen Bezugsgröße (<strong>2011</strong>:<br />
851,67 EUR) abzuziehen. Für jede Kind, das gemäß § 10<br />
SGB V familienversichert ist, 1/5 der monatlichen Bezugsgröße<br />
(<strong>2011</strong>: 511 EUR). Die Obergrenze für die Beitragsbemessung<br />
sind 50% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze.<br />
Beispiel 1 – Kind ist in der P<strong>KV</strong> versichert:<br />
• P<strong>KV</strong>-versicherter Mann: 5.000 EUR monatliche Einnahmen<br />
• Ehefrau nicht versichert: 400 EUR monatliche Einnahmen<br />
(Minijob)<br />
• P<strong>KV</strong>-versichertes Kind: keine Einnahmen<br />
Von den Einnahmen des Mannes werden noch 851,67 EUR für<br />
das Kind abgezogen. Die verbleibenden 4.160 EUR liegen über<br />
der Beitragsbemessungsgrenze (BBG). Deshalb werden für die<br />
Ehefrau maximal (3.712,50 : 2 =) 1.856,25 EUR zugrunde<br />
gelegt.<br />
• G<strong>KV</strong>-Beitrag Ehefrau: 1.856,25 x 14,9% = 276,58 EUR<br />
Beispiel 2 – Kind ist in der G<strong>KV</strong> familienversichert:<br />
• P<strong>KV</strong> versicherter Ehemann (Beamter): 3.000 EUR monatliche<br />
Einnahmen<br />
• G<strong>KV</strong> (freiwillig) versicherte Ehefrau: 0 EUR mtl. Einnahmen<br />
• G<strong>KV</strong> versichertes Kind: 0 EUR mtl. Einnahmen<br />
Von den Einnahmen des Mannes werden noch 504 EUR für<br />
das Kind abgezogen. Die verbleibenden 2.496 EUR liegen<br />
unter der Beitragsbemessungsgrenze. Deshalb werden für<br />
die Frau (2.496 : 2 =) 1.248,00 EUR zugrunde gelegt.<br />
• G<strong>KV</strong> Beitrag für die Ehefrau: 1.248,00 x 14,3% =<br />
178,46 EUR<br />
86 zurück zum Inhaltsverzeichnis


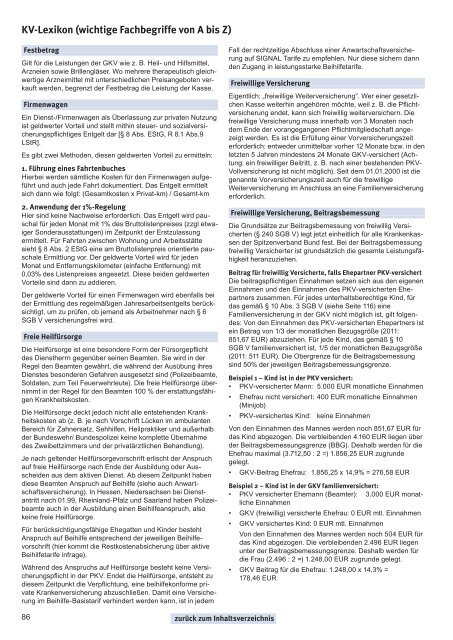

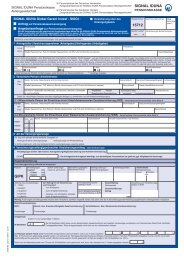






![ALLWEST Satzung [Fo.-Nr. 2001301 Aug09] (65 kB)](https://img.yumpu.com/30585729/1/184x260/allwest-satzung-fo-nr-2001301-aug09-65-kb.jpg?quality=85)