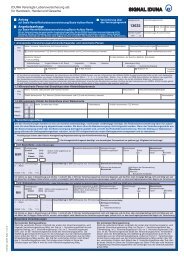KV-Handbuch 2011 - SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG
KV-Handbuch 2011 - SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG
KV-Handbuch 2011 - SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>KV</strong>-Lexikon (wichtige Fachbegriffe von A bis Z)<br />
Gebührenordnung für Ärzte/ Zahnärzte (GOÄ/ GOZ)<br />
Die GOÄ/ GOZ sind Grundlage für die Vergütung privatärztlicher<br />
Leistungen. Das Spektrum der ärztlichen/ zahnärztlichen<br />
Leistungen wird in Einzelpositionen aufgegliedert, die nach den<br />
Vorschriften der Gebührenordnungen in Rechnung gestellt werden<br />
können. Jede einzelne Leistung erhält dabei eine eigene<br />
Gebührenordnungsziffer.<br />
Die Bemessung der Gebühren beruht auf einem System von<br />
Punktzahlen für die einzelnen in den Gebührenverzeichnissen<br />
aufgeführten Leistungen und einem für sämtliche Leistungen<br />
einheitlichen Punktwert.<br />
Der Punktwert beträgt aktuell in der GOÄ 5,82873 Cent, in der<br />
GOZ 5,62421 Cent. Die Multiplikation des Punktwertes mit der<br />
Punktzahl der einzelnen Leistungen ergibt den einfachen<br />
Gebührensatz. Für die Bemessung der einzelnen Gebühr sieht<br />
die Gebührenordnung einen Gebührenrahmen vor.<br />
Der Rahmen der Gebührenordnungen liegt bei folgenden Sätzen:<br />
a) ohne Begründung des Arztes<br />
• für persönliche Leistungen bis 2,3-fach<br />
• für technische Leistungen der GOÄ Abschnitte A, E und O<br />
bis 1,8-fach<br />
• für technische Leistungen der GOÄ-Nr. 437 sowie des<br />
Abschnittes M 1,15-fach<br />
Diese Sätze werden als Regelhöchstsätze (= Schwellenwerte)<br />
bezeichnet.<br />
b) mit Begründung des Arztes<br />
• für persönliche Leistungen bis 3,5-fach<br />
• für technische Leistungen der GOÄ Abschnitte A, E und 0<br />
bis 2,5-fach<br />
• für technische Leistungen der GOÄ-Nr. 437 sowie des<br />
Abschnittes M 1,3-fach<br />
Diese Sätze werden als Höchstsätze bezeichnet.<br />
In der Regel darf eine Gebühr für persönliche Leistungen nur<br />
zwischen dem einfachen und dem 2,3-fachen des Gebührensatzes<br />
bemessen sein, ein Überschreiten des 2,3-fachen<br />
Gebührensatzes (= Schwellenwert) ist nur zulässig, wenn<br />
Besonderheiten dieses rechtfertigen (schriftliche Begründung<br />
des Arztes auf der Rechnung).<br />
Will der Arzt ein über den Rahmen der Gebührenordnung, also<br />
über den Höchstsatz hinausgehendes Honorar mit dem Patienten<br />
vereinbaren, ist hierüber vorher eine schriftliche Vereinbarung<br />
zu treffen. An die Rechtmäßigkeit einer solchen Honorarvereinbarung<br />
sind strenge Bedingungen geknüpft.<br />
Wir empfehlen in den Fällen, in denen eine Honorarvereinbarung<br />
getroffen werden soll, die vorherige Abstimmung mit unserer<br />
Leistungsabteilung. Dabei kann rechtzeitig die rechtliche<br />
Zulässigkeit der Überschreitung der Höchstsätze und die Höhe<br />
der <strong>SIGNAL</strong> Erstattung geklärt werden.<br />
Beispiel für eine Honorarabrechnung:<br />
eingehende Beratung nach GOÄ-Ziffer 3<br />
Punktzahl: 150 Punkte x Punktwert 5,82873 Cent = Gebühr<br />
8,74 EUR<br />
1-facher Gebührensatz: 8,74 EUR<br />
1,7-facher Gebührensatz: 14,86 EUR<br />
2,3-facher Gebührensatz: 20,10 EUR<br />
3,5-facher Gebührensatz: 30,50 EUR (mit Begründung)<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
Hinweis für die neuen Bundesländer (inkl. Ost-Berlin): Der Arztabschlag<br />
in Höhe von 10% ist seit dem 1.1.2007 weggefallen.<br />
Damit ist das Vergütungsniveau für Ärzte und Zahnärzte in Ostund<br />
Westdeutschland einheitlich.<br />
Geringfügige Beschäftigung<br />
Seit dem 01.04.2003 sind Beschäftigte in der Sozialversicherung<br />
geringfügig beschäftigt, wenn das Monatseinkommen<br />
höchstens 400 EUR beträgt. Die Einkommensgrenze von<br />
400 EUR wird nicht angepasst und gilt bundesweit sowohl in<br />
den alten als auch in den neuen Bundesländern.<br />
Wichtig: Eine einzige geringfügige Beschäftigung wird nicht mit<br />
einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung zusammengerechnet.<br />
Lediglich die geringfügigen Beschäftigungen<br />
selbst werden addiert.<br />
geringfügige Beschäftigung ohne versicherungspflichtige<br />
Hauptbeschäftigung<br />
(Nur) der Arbeitgeber hat vom Einkommen aus der geringfügigen<br />
Beschäftigung (also höchstens von 400 EUR) Pauschal -<br />
abgaben von 30 % zu zahlen: 13 % zur gesetz lichen Krankenversicherung,<br />
15 % zur gesetzlichen Renten versicherung (GRV)<br />
und 2 % Pauschalsteuer. Durch diese Beitragspflicht wird keine<br />
eigenständige versicherungspflich tige Mitgliedschaft in der<br />
G<strong>KV</strong> begründet. Die geringfügige Beschäftigung bleibt versicherungsfrei.<br />
An die G<strong>KV</strong> entstehen keine weiteren Ansprüche<br />
(z. B. auf Krankengeld). Mehrere geringfügige Beschäftigungen<br />
werden weiterhin zusammen gerechnet. Darüber hinaus müssen<br />
noch Beiträge an die Berufsgenossenschaft und Umlagebeiträge<br />
zur Lohnfortzahlung und für den Mutterschutz gezahlt<br />
werden (siehe Aufwendungsausgleichsgesetz, Seite 74).<br />
Anders dagegen in der GRV: Der Versicherte erwirbt durch den<br />
Pauschalbeitrag des Arbeitgebers neue - aber geminderte -<br />
Leistungsansprüche. Er hat aber auch die Möglich keit, im Rahmen<br />
der geringfügigen Beschäftigung auf die Versicherungsfreiheit<br />
zu verzichten. Der Arbeitnehmer hat dann aus eigener<br />
Tasche die Differenz zum gültigen Beitrags satz zu zahlen, dafür<br />
erhält er dann die „normalen“ GRV-Leis tungs ansprüche.<br />
Hinweis für privat Krankenversicherte: Der pauschale Arbeitgeberbeitrag<br />
von 13 % an die G<strong>KV</strong> ist nur für gesetzlich Krankenversicherte<br />
(entweder selbst versichert oder familienversichert)<br />
zu entrichten. Der Arbeitgeber spart somit bei privat Krankenversicherten<br />
diesen 13 %igen Pauschalbeitrag - sicherlich ein<br />
Argument für die P<strong>KV</strong>.<br />
eine geringfügige Beschäftigung mit versicherungspflichtiger<br />
Hauptbeschäftigung<br />
Eine geringfügige Beschäftigung wird mit der versicherungspflichtigen<br />
Hauptbeschäftigung nicht zusammengerechnet.<br />
Der Arbeitgeber kann dadurch in der geringfügigen Beschäftigung<br />
die pauschalen Arbeitgeberbeiträge weiter entrichten. Es<br />
besteht somit nur für die Hauptbeschäftigung „normale“ Sozialversicherungspflicht<br />
mit den „normalen“ Beitrags sätzen. Arbeitgeber<br />
und Arbeitnehmer tragen für die Haupt beschäfti gung die<br />
Beiträge je zur Hälfte.<br />
Wichtig für die <strong>KV</strong>:<br />
Da die Einkommen aus den Beschäftigungen nicht zusammengerechnet<br />
werden, kann die Aufnahme einer geringfügigen<br />
Beschäftigung im jeweiligen Einzelfall nicht mehr zum Überschreiten<br />
der Jahresarbeitsentgeltgrenze führen. Dies gilt nur<br />
für die erste geringfügige Beschäftigung. Die zweite und jede<br />
weitere wird jedoch mit der Hauptbeschäftigung addiert, sodass<br />
es in diesen Fällen zum Überschreiten der JAEG kommen kann.<br />
Meldepflicht<br />
Jede geringfügige Beschäftigung muss der Einzugsstelle<br />
87<br />
<strong>KV</strong>-Lexikon




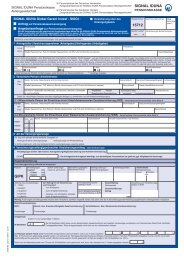






![ALLWEST Satzung [Fo.-Nr. 2001301 Aug09] (65 kB)](https://img.yumpu.com/30585729/1/184x260/allwest-satzung-fo-nr-2001301-aug09-65-kb.jpg?quality=85)