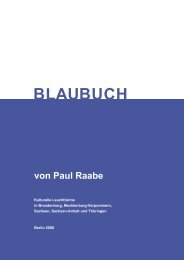Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nachteile entstehen dürfen. Meist geht es dabei um die Kosten der Unterhaltung<br />
des Baudenkmales, weshalb sich zu Zeiten knapper Haushalte jene<br />
Prozesse mehren, in denen Gerichte zu entscheiden haben, ob eine Maßnahme<br />
dem Eigentümer aufgr<strong>und</strong> der Sozialbindung des Eigentums zumutbar<br />
ist oder der Staat die Zumutbarkeit durch direkte oder indirekte finanzielle<br />
Leistungen herstellen muss.<br />
Maßnahmen der Gefahrenabwehr muss der Eigentümer hingegen selber tragen,<br />
weshalb die Bauaufsicht einen Gefahrenzustand nur mit dem „geringsten<br />
Mittel“ abwenden darf. Abstützungen, Dacherneuerung <strong>und</strong> ähnliche<br />
kostenintensive Maßnahmen gehören in der Regel nicht dazu. So wird<br />
eine von einem Baudenkmal ausgehende Gefahr oft durch einen Abbruch<br />
beseitigt, was natürlich einen Konflikt mit dem Denkmalpfleger mit sich<br />
bringt. Damit gewinnt die Frage, ob eine bauaufsichtliche Forderung in der<br />
Gefahrenabwehr begründet ist oder dem Kulturgüterschutz dient, auch eine<br />
finanzielle Bedeutung. Die Schwierigkeiten, im Einzelfall die Abgrenzungsprobleme<br />
zu lösen, können hier nicht erläutert werden.<br />
Selbst im Interesse der Gefahrenabwehr darf die Freiheit des Bürgers<br />
nur möglichst wenig eingeschränkt werden. Die Fürsorgepflicht des Staates<br />
erstreckt sich deshalb nur auf Mindestanforderungen des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes;<br />
dem Bürger ist es frei gestellt, zu seinem Schutz auf eigene Kosten mehr<br />
zu tun als in den Landesbauordnungen vorgeschrieben ist. Fordern kann der<br />
Staat nur den Mindestsicherheitsstandard, der in den Landesbauordnungen<br />
festgeschrieben ist; ob <strong>und</strong> wie der Bürger sein Eigentum zusätzlich schützt,<br />
bleibt allein seinem eigenen Empfinden <strong>und</strong> seinen Möglichkeiten überlassen.<br />
So steht es dem Eigentümer auch frei, ob er sein Eigentum versichert. Die<br />
Versicherungen können nur den materiellen Schaden ersetzen. Für Kulturdenkmäler<br />
ist dies nur selten eine befriedigende Lösung; ich erinnere hier<br />
an ein umfangreiches Lehrbuch der Hessischen Brandversicherung aus den<br />
frühen 1980er Jahren, in dem beispielhaft <strong>und</strong> ausführlich die Brandversicherungssumme<br />
der frühgotischen Elisabethkirche in Marburg kalkuliert<br />
wird. Danach bestand der Neubau natürlich aus sandsteinfarbenem Beton,<br />
Gipsabdrücken <strong>und</strong> Fototapeten; eben „neu <strong>für</strong> alt“. Und wer <strong>für</strong> seine alten<br />
Eichenbalken an Stelle von billigem Nadelholz wieder Eichenholz haben<br />
wollte, musste die Mehrkosten zusätzlich versichern. Andererseits konnte damals<br />
der Eigentümer aber auch deutliche Beitragsermäßigungen aushandeln,<br />
wenn er in Abstimmung mit der Brandversicherung technische Maßnahmen<br />
zur Vermeidung von Entstehungsbränden vorsah, die weit über die Forderungen<br />
der Landesbauordnung hinausgingen. Oder anders ausgedrückt: je teurer<br />
die <strong>Sicherheit</strong>seinrichtungen, um so billiger die Brandversicherung.<br />
Es ist also nicht Aufgabe der Bauordnung, Brände zu verhindern, Baudenkmäler<br />
zu retten <strong>und</strong> Kulturgüter zu schützen, sondern Menschen zu retten. Um<br />
es drastisch auszudrücken: Die Landesbauordnung hat ihre Aufgabe erfüllt,<br />
wenn die Eigentümer nachts um drei im Nachthemd auf der Gasse stehen<br />
<strong>und</strong> zuschauen, wie ihr Baudenkmal abbrennt.<br />
Dies bedeutet natürlich Konflikte mit all den Vertretern von Institutionen,<br />
die Kulturgüter schützen, retten <strong>und</strong> bewahren wollen. Die Konflikte werden<br />
umso größer, je höher die Erwartungshaltung der Kuratoren ist <strong>und</strong> je<br />
weniger eine Bauaufsicht mangels Zuständigkeit erfüllen kann. Die Konflikte<br />
sind auch in den ambivalenten Wirkungen von <strong>Sicherheit</strong>smaßnahmen begründet,<br />
z.B. wenn die Bauaufsicht die ständige ungehinderte Freihaltung der<br />
Rettungswege fordert, sich aber nicht darum zu kümmern braucht, dass Rettungswege<br />
gerne in umgekehrter Richtung von Einbrechern genutzt werden.<br />
Oder wenn zwar das Feuer durch Wasser schnell gelöscht werden kann,<br />
aber die Wasserschäden <strong>für</strong> die <strong>Sicherheit</strong>sbehörden ohne jegliches<br />
Interesse sind.<br />
Dennoch glauben viele Kunsthistoriker, dass die Bauaufsichtsbehörden<br />
durch ihre Forderungen zur Abwehr von Gefahren <strong>für</strong> Menschen auch ihre<br />
Kulturgüter ausreichend schützen. Selbstverständlich müssen die Vorschriften<br />
zur Gefahrenabwehr <strong>für</strong> Menschen auch in <strong>Museen</strong> <strong>und</strong> <strong>Archive</strong>n erfüllt<br />
werden; der Schutz von Kulturgütern erfordert in der Regel jedoch andersartige<br />
<strong>und</strong> weitergehende Maßnahmen, die mangels Zuständigkeit nicht von<br />
der Bauaufsicht erhoben werden können. Die Mitarbeiter der Bauaufsicht<br />
<strong>und</strong> der Feuerwehren sind <strong>für</strong> derartige Maßnahmen auch nicht ausgebildet<br />
<strong>und</strong> folglich auch nicht fachk<strong>und</strong>ig. Technische Vorschriften oder gar technische<br />
Behörden zum Schutz der Kulturgüter gibt es nicht; wie die <strong>Museen</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Archive</strong> ihre Kulturgüter vor äußeren Einwirkungen wirkungsvoll <strong>und</strong><br />
zweckmäßig schützen, bleibt ihnen allein überlassen.<br />
Wenn also einer der maßgeblichen Landeskonservatoren laut beklagt,<br />
dass im Bereich des Brandschutzes alles so schön eindeutig geregelt sei, im<br />
Denkmalschutz aber alles ungeregelt sei, so offenbart dies nicht nur Unkenntnis<br />
der rechtlichen Systematik, sondern auch fachliche Unbedarftheit.<br />
Denn nur aus Bequemlichkeit kann behauptet werden, dass die Bauordnung<br />
dem Kulturgüterschutz dient; <strong>und</strong> nur bei oberflächlichem Betrachten kann<br />
der Eindruck entstehen, dass im Bereich des baulichen Gefahrenabwehrrechts<br />
alles eindeutig geregelt sei.<br />
Zwar hat der Staat zur Rettung von Menschenleben eindeutige <strong>Sicherheit</strong>sziele<br />
<strong>und</strong> <strong>Sicherheit</strong>sstandards gesetzt, hütet sich aber davor, durch Gesetze<br />
oder gesetzesgleiche Baubestimmungen <strong>für</strong> den Einzelfall allzu detaillierte<br />
36 37