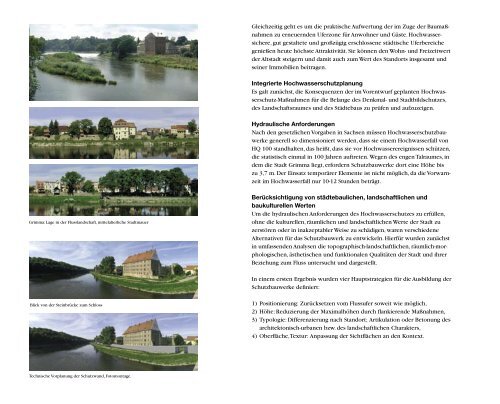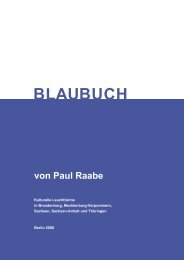Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Grimma: Lage in der Flusslandschaft, mittelalterliche Stadtmauer<br />
Blick von der Steinbrücke zum Schloss<br />
Technische Vorplanung der Schutzwand, Fotomontage.<br />
Gleichzeitig geht es um die praktische Aufwertung der im Zuge der Baumaßnahmen<br />
zu erneuernden Uferzone <strong>für</strong> Anwohner <strong>und</strong> Gäste. Hochwassersichere,<br />
gut gestaltete <strong>und</strong> großzügig erschlossene städtische Uferbereiche<br />
genießen heute höchste Attraktivität. Sie können den Wohn- <strong>und</strong> Freizeitwert<br />
der Altstadt steigern <strong>und</strong> damit auch zum Wert des Standorts insgesamt <strong>und</strong><br />
seiner Immobilien beitragen.<br />
Integrierte Hochwasserschutzplanung<br />
Es galt zunächst, die Konsequenzen der im Vorentwurf geplanten Hochwasserschutz-Maßnahmen<br />
<strong>für</strong> die Belange des Denkmal- <strong>und</strong> Stadtbildschutzes,<br />
des Landschaftsraumes <strong>und</strong> des Städtebaus zu prüfen <strong>und</strong> aufzuzeigen.<br />
Hydraulische Anforderungen<br />
Nach den gesetzlichen Vorgaben in Sachsen müssen Hochwasserschutzbauwerke<br />
generell so dimensioniert werden, dass sie einem Hochwasserfall von<br />
HQ 100 standhalten, das heißt, dass sie vor Hochwasserereignissen schützen,<br />
die statistisch einmal in 100 Jahren auftreten. Wegen des engen Talraumes, in<br />
dem die Stadt Grimma liegt, erfordern Schutzbauwerke dort eine Höhe bis<br />
zu 3,7 m. Der Einsatz temporärer Elemente ist nicht möglich, da die Vorwarnzeit<br />
im Hochwasserfall nur 10-12 St<strong>und</strong>en beträgt.<br />
Berücksichtigung von städtebaulichen, landschaftlichen <strong>und</strong><br />
baukulturellen Werten<br />
Um die hydraulischen Anforderungen des Hochwasserschutzes zu erfüllen,<br />
ohne die kulturellen, räumlichen <strong>und</strong> landschaftlichen Werte der Stadt zu<br />
zerstören oder in inakzeptabler Weise zu schädigen, waren verschiedene<br />
Alternativen <strong>für</strong> das Schutzbauwerk zu entwickeln. Hier<strong>für</strong> wurden zunächst<br />
in umfassenden Analysen die topographisch-landschaftlichen, räumlich-morphologischen,<br />
ästhetischen <strong>und</strong> funktionalen Qualitäten der Stadt <strong>und</strong> ihrer<br />
Beziehung zum Fluss untersucht <strong>und</strong> dargestellt.<br />
In einem ersten Ergebnis wurden vier Hauptstrategien <strong>für</strong> die Ausbildung der<br />
Schutzbauwerke definiert:<br />
1) Positionierung: Zurücksetzen vom Flussufer soweit wie möglich,<br />
2) Höhe: Reduzierung der Maximalhöhen durch flankierende Maßnahmen,<br />
3) Typologie: Differenzierung nach Standort; Artikulation oder Betonung des<br />
architektonisch-urbanen bzw. des landschaftlichen Charakters,<br />
4) Oberfläche, Textur: Anpassung der Sichtflächen an den Kontext.