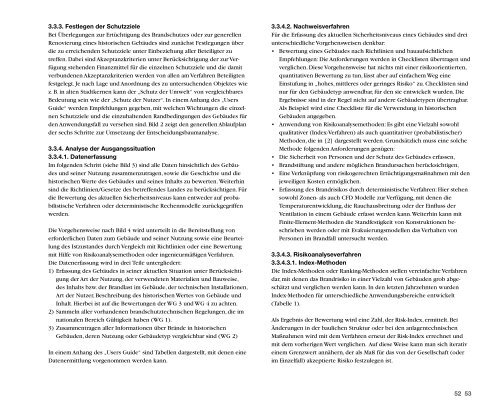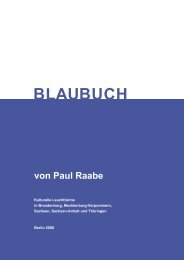Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.3.3. Festlegen der Schutzziele<br />
Bei Überlegungen zur Ertüchtigung des Brandschutzes oder zur generellen<br />
Renovierung eines historischen Gebäudes sind zunächst Festlegungen über<br />
die zu erreichenden Schutzziele unter Einbeziehung aller Beteiligter zu<br />
treffen. Dabei sind Akzeptanzkriterien unter Berücksichtigung der zur Verfügung<br />
stehenden Finanzmittel <strong>für</strong> die einzelnen Schutzziele <strong>und</strong> die damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Akzeptanzkriterien werden von allen am Verfahren Beteiligten<br />
festgelegt. Je nach Lage <strong>und</strong> Anordnung des zu untersuchenden Objektes wie<br />
z. B. in alten Stadtkernen kann der „Schutz der Umwelt“ von vergleichbares<br />
Bedeutung sein wie der „Schutz der Nutzer“. In einem Anhang des „Users<br />
Guide“ werden Empfehlungen gegeben, mit welchen Wichtungen die einzelnen<br />
Schutzziele <strong>und</strong> die einzuhaltenden Randbedingungen des Gebäudes <strong>für</strong><br />
den Anwendungsfall zu versehen sind. Bild 2 zeigt den generellen Ablaufplan<br />
der sechs Schritte zur Umsetzung der Entscheidungsbaumanalyse.<br />
3.3.4. Analyse der Ausgangssituation<br />
3.3.4.1. Datenerfassung<br />
Im folgenden Schritt (siehe Bild 3) sind alle Daten hinsichtlich des Gebäudes<br />
<strong>und</strong> seiner Nutzung zusammenzutragen, sowie die Geschichte <strong>und</strong> die<br />
historischen Werte des Gebäudes <strong>und</strong> seines Inhalts zu bewerten. Weiterhin<br />
sind die Richtlinien/Gesetze des betreffendes Landes zu berücksichtigen. Für<br />
die Bewertung des aktuellen <strong>Sicherheit</strong>sniveaus kann entweder auf probabilistische<br />
Verfahren oder deterministische Rechenmodelle zurückgegriffen<br />
werden.<br />
Die Vorgehensweise nach Bild 4 wird unterteilt in die Bereitstellung von<br />
erforderlichen Daten zum Gebäude <strong>und</strong> seiner Nutzung sowie eine Beurteilung<br />
des Istzustandes durch Vergleich mit Richtlinien oder eine Bewertung<br />
mit Hilfe von Risikoanalysemethoden oder ingenieurmäßigen Verfahren.<br />
Die Datenerfassung wird in drei Teile untergliedert:<br />
1) Erfassung des Gebäudes in seiner aktuellen Situation unter Berücksichti-<br />
gung der Art der Nutzung, der verwendeten Materialien <strong>und</strong> Bauweise,<br />
des Inhalts bzw. der Brandlast im Gebäude, der technischen Installationen,<br />
Art der Nutzer, Beschreibung des historischen Wertes von Gebäude <strong>und</strong><br />
Inhalt. Hierbei ist auf die Bewertungen der WG 3 <strong>und</strong> WG 4 zu achten.<br />
2) Sammeln aller vorhandenen brandschutztechnischen Regelungen, die im<br />
nationalen Bereich Gültigkeit haben (WG 1).<br />
3) Zusammentragen aller Informationen über Brände in historischen<br />
Gebäuden, deren Nutzung oder Gebäudetyp vergleichbar sind (WG 2)<br />
In einem Anhang des „Users Guide“ sind Tabellen dargestellt, mit denen eine<br />
Datenermittlung vorgenommen werden kann.<br />
3.3.4.2. Nachweisverfahren<br />
Für die Erfassung des aktuellen <strong>Sicherheit</strong>sniveaus eines Gebäudes sind drei<br />
unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar:<br />
• Bewertung eines Gebäudes nach Richtlinien <strong>und</strong> bauaufsichtlichen<br />
Empfehlungen: Die Anforderungen werden in Checklisten übertragen <strong>und</strong><br />
verglichen. Diese Vorgehensweise hat nichts mit einer risikoorientierten,<br />
quantitativen Bewertung zu tun, lässt aber auf einfachem Weg eine<br />
Einstufung in „hohes, mittleres oder geringes Risiko“ zu. Checklisten sind<br />
nur <strong>für</strong> den Gebäudetyp anwendbar, <strong>für</strong> den sie entwickelt wurden. Die<br />
Ergebnisse sind in der Regel nicht auf andere Gebäudetypen übertragbar.<br />
Als Beispiel wird eine Checkliste <strong>für</strong> die Verwendung in historischen<br />
Gebäuden angegeben.<br />
• Anwendung von Risikoanalysemethoden: Es gibt eine Vielzahl sowohl<br />
qualitativer (Index-Verfahren) als auch quantitativer (probabilistischer)<br />
Methoden, die in [2] dargestellt werden. Gr<strong>und</strong>sätzlich muss eine solche<br />
Methode folgenden Anforderungen genügen:<br />
• Die <strong>Sicherheit</strong> von Personen <strong>und</strong> der Schutz des Gebäudes erfassen,<br />
• Brandstiftung <strong>und</strong> andere möglichen Brandursachen berücksichtigen,<br />
• Eine Verknüpfung von risikogerechten Ertüchtigungsmaßnahmen mit den<br />
jeweiligen Kosten ermöglichen.<br />
• Erfassung des Brandrisikos durch deterministische Verfahren: Hier stehen<br />
sowohl Zonen- als auch CFD Modelle zur Verfügung, mit denen die<br />
Temperaturentwicklung, die Rauchausbreitung oder der Einfluss der<br />
Ventilation in einem Gebäude erfasst werden kann. Weiterhin kann mit<br />
Finite-Element-Methoden die Standfestigkeit von Konstruktionen be-<br />
schrieben werden oder mit Evakuierungsmodellen das Verhalten von<br />
Personen im Brandfall untersucht werden.<br />
3.3.4.3. Risikoanalyseverfahren<br />
3.3.4.3.1. Index-Methoden<br />
Die Index-Methoden oder Ranking-Methoden stellen vereinfachte Verfahren<br />
dar, mit denen das Brandrisiko in einer Vielzahl von Gebäuden grob abgeschätzt<br />
<strong>und</strong> verglichen werden kann. In den letzten Jahrzehnten wurden<br />
Index-Methoden <strong>für</strong> unterschiedliche Anwendungsbereiche entwickelt<br />
(Tabelle 1).<br />
Als Ergebnis der Bewertung wird eine Zahl, der Risk-Index, ermittelt. Bei<br />
Änderungen in der baulichen Struktur oder bei den anlagentechnischen<br />
Maßnahmen wird mit dem Verfahren erneut der Risk-Index errechnet <strong>und</strong><br />
mit dem vorherigen Wert verglichen. Auf diese Weise kann man sich iterativ<br />
einem Grenzwert annähern, der als Maß <strong>für</strong> das von der Gesellschaft (oder<br />
im Einzelfall) akzeptierte Risiko festzulegen ist.<br />
52 53