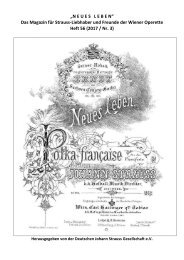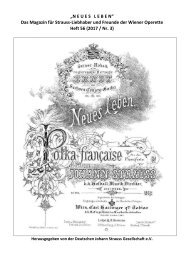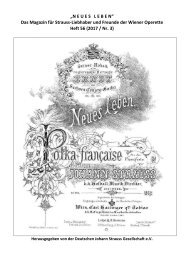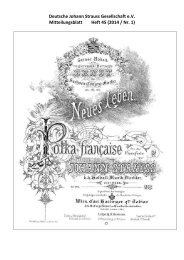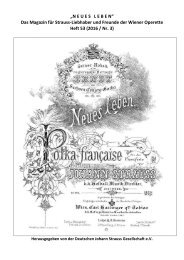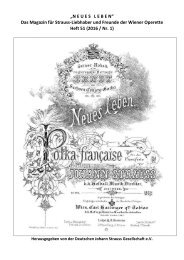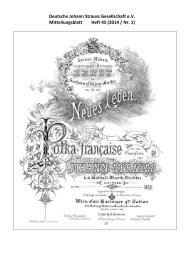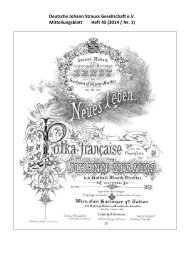NeuesLeben-012016
Und wieder ein neues Heft!
Und wieder ein neues Heft!
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
In der Endfassung ist der Walzer-Nr. 5 allerdings noch eine zehn Takte lange „Einleitung“ vorangestellt.<br />
Strauss konnte sein Orchester nicht zur Verfügung stellen, weil in der Karnevalsrevue 1867 rekordverdächtige<br />
„25 Novitäten der Brüder Strauss“ aufzuführen waren (Mailer II, S. 34). Außerdem war Strauss<br />
in den Vorbereitungen für sein Paris-Engagement mit dem deutschen (Liegnitzer) Bilse-Orchester vollauf<br />
beschäftigt. So musste Weinwurm sich nach Ersatz umschauen – wobei die vom k.k. Volksgarten her<br />
bekannte Militärkapelle des IR 42 ihre Chance erhielt.<br />
In welcher Formation die Uraufführung am 15. Februar 1867 erfolgte, erfahren wir aus den Zeitungskritiken<br />
oder von Augenzeugen n i c h t. Es ist nicht einmal klargestellt, ob Strauss und/oder Wiedemann<br />
an der Veranstaltung teilnahmen. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest Wiedemann anwesend<br />
war.<br />
Die Militärkapelle hatte in dem neunteiligen Programm (siehe u. a. bei Anzenberger-Ramminger) bei<br />
vier Teilen mitzuwirken: 1. Ouvertüre für Orchester (?) – 3. Antik? O ne! Moderne Konzertaufführung für<br />
Chor, Solo, Deklamation und Orchester... Musik von Konradin – nach der Pause: 6. AN DER SCHÖNEN<br />
BLAUEN DONAU, Walzer für Chor und Orchester von Johann Strauss (neu) – 9. Die Sängerfahrt nach Peking.<br />
Große lyrisch-romantisch-tragische Operette mit Ballett in einem Akte. Musik von Julius Otto.<br />
Von Interesse sind auch die mitbeteiligten Komponisten:<br />
Konradin, Pseudonym für Karl Ferdinand Kohn (1833 Helenental b. Baden - 1884 Wien), besuchte in<br />
Wien das Polytechnikum, wandte sich aber autodidaktisch der Musik zu. Ab 1859 wirkte er als Komponist<br />
und Kapellmeister, wobei er nicht weniger als 16 Operetten zur Aufführung brachte, u. a. (mit Nestroy)<br />
im Carl-Theater, auch am Theater a. d. Wien (1861 „Der Drachenstein“ 9 mal). Mehrere Libretti für<br />
Konradin schrieb der Wiener Magistratsbeamte Erik Neßl (Pseudonym für Hippolyth Kneißer, 1831 -<br />
1883). Auch in Prag, Olmütz, Brünn, Pest usw. kam es zu Aufführungen.<br />
Ernst Julius Otto, 1804 in Königstein in der Sächsischen Schweiz nahe der tschechischen Grenze geboren<br />
(er starb 1877 in Dresden), war Schüler der Thomaskantoren Johann Gottfried Schicht und Christian<br />
Theodor Weinlig (Lehrer auch von Richard Wagner und Clara Schumann). In Dresden wirkte Otto ab<br />
1830 als Kantor der Kreuzkirche sowie als Dirigent der Dresdener Liedertafel. Für dieses Metier schuf er<br />
zahlreiche Zyklen, auch Oratorien und zwei Opern. Julius-Otto-Denkmäler befinden sich auf dem Platz<br />
zwischen der Dresdener Kreuzkirche und dem Hotel am Altmarkt sowie vor seinem Geburtshaus in Königstein.<br />
Die Militärkapelle des IR 42 war mit der Formation des Strauss-Orchesters nicht vergleichbar. Wenn<br />
auch die Nordböhmen (zum Teil) eine volle Streichergruppe integrieren konnten, so stand doch die<br />
„Harmonie“ (= Bläsergruppen mit Schlagzeug) absolut im Vordergrund. Bei der Unterschiedlichkeit von<br />
Militärkapell-Besetzungen wäre vorauszusetzen, dass am besten über die konkrete Formation der jeweilige<br />
Militärkapellmeister Bescheid wüsste. Dies legt nahe, dass die Instrumentation (bei der bekannten<br />
Schwäche von Strauss im Umgang mit transponierenden Instrumenten) vom Komponisten Josef Wiedemann<br />
besorgt sein könnte – etwa in der Art, wie Josef Kaschte am 1. Aug. 1867 sie für die Militärkapelle<br />
des IR 21 abgeschrieben oder rekonstruiert hat (siehe Österreichische Nationalbibliothek Wien<br />
Mus. Hs. 20.939). Kaschte war ebenfalls Komponist (u. a. „Schwarzenberg Marsch“).<br />
Möglich ist aber auch, dass der für Strauss seit 1844 instrumentierende Militärkapellmeister des IR 12<br />
und Komponist Johann Proksch bei der Instrumentation tätig geworden war oder mitgeholfen hat.<br />
Proksch besorgte in jenen (jeden Kapellmeister überfordernden) Tagen auch die Instrumentation der<br />
drei Tage zuvor im Sophiensaal uraufgeführten Walzer „Telegramme“, op. 318 (siehe SEV S. 494: hand-<br />
41