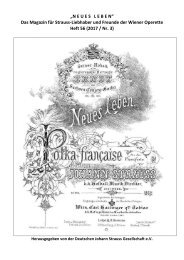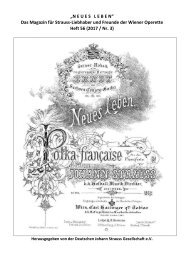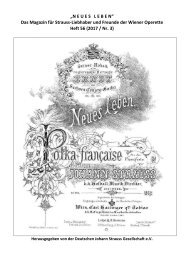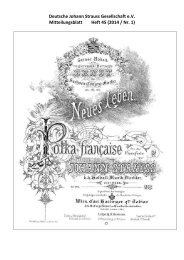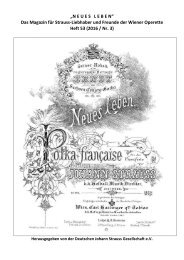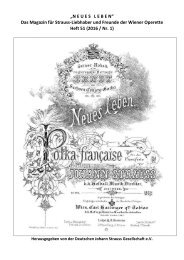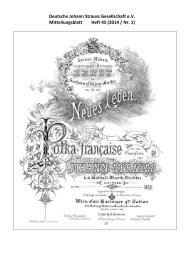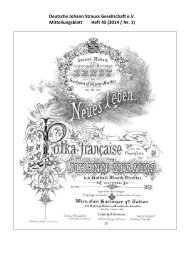NeuesLeben-012016
Und wieder ein neues Heft!
Und wieder ein neues Heft!
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Daneben bezog sich Strauss auf Motive der „Klangfiguren“, op. 251 (3a „Donau“ 3a und 5a “ Donau“<br />
4b), der „Fünf Paragraphe aus dem Walzer-Codex“, op. 105 (2b „Donau“ 3b), der Walzer „Gedankenflug“,<br />
op. 215 (5a „Donau“ 5b) und „Motoren“ op. 265 (4b „Donau“ 2b).<br />
Eins dieser Werke (op. 215) war 1858 in Pawlowsk uraufgeführt worden. Drei Werke im Wiener Sophiensaal<br />
(op. 105 Juristenball 1852; op. 251 Technikerball 1861 und op. 265 Technikerball 1862). Im<br />
Dianasaal wiederum, Stätte der Uraufführung von op. 314, waren am 3. März 1862 bei einem Benefiz-<br />
Konzert der Strauss-Brüder die Walzer „Wiener Chronik“, op. 268 erstmals dargeboten worden. Ihr entnahm<br />
Strauss die vier Motive zu 1a, 1b, 4a und 5a – im Vertrauen darauf, dass nach beinahe 5 Jahren<br />
von einem anderen Publikum keiner der neuen Hörer die Verwandtschaft von Melodien feststellen würde.<br />
Für die besondere Vorgehensweise von Strauss haben wir als mögliche Begründung zwei Versionen<br />
anzubieten (nicht nur alternativ). Zum einen: Er hatte vorhandene Melodiesammlungen bereits hinreichend<br />
ausgewertet – aus dem Skizzenbuch für „Künstlerleben“, op. 316, die Motive 1a und 2b; aus der<br />
Walzersammlung MHc-7753 für „Bürgerweisen“, op. 306, die Motive 2b, 3a, 4a, 4b – für „Wiener Bonbons“,<br />
op. 307, das Motiv 1a usw.<br />
Zum anderen: Der Verlegerwechsel Ende 1863 / Anfang 1864 von Haslinger zu Spina (erste Edition:<br />
„Morgenblätter“, op. 279) hatte Strauss unter vermehrten Erwartungsdruck gesetzt. Er glaubte, ihm nur<br />
standhalten zu können, indem er neue Wege beschritt, indem er durch Anleihen beim Vater sein melodisches<br />
Repertoire zu verbreitern trachtete – vgl. in den „Morgenblättern“, die Melodie 2a mit des Vaters<br />
Melodie 4a der „Österreichischen Jubelklänge“, op.179 (Linke 1987, S. 239, 226ff.).<br />
Auf diesem Wege fortschreitend, bedeutete das Aufgreifen und Fortwickeln eigener Melodien den Vorteil,<br />
dass er auch auf die Instrumentationen der recycelten Melodien zurückgreifen konnte, die ggf. nur<br />
wenig zu ergänzen waren. Man vergleiche (als ein Beispiel) die Instrumentation von op. 251: 3a der<br />
„Klangfiguren“ (Kraus-Partitur MHc-12221) mit jener von op. 314: 3a „An der schönen blauen Donau“ –<br />
etwa die Bassstimme (Strauss-Kapelle Kraus-Stimme MHc-12199):<br />
G (4-mal) = A (1-mal) = d (1-mal) = g = G<br />
G (6-mal) = A (2-mal) = d (2-mal) = g = G<br />
Neben dem bekannten Merkmal der Erweiterung bei den drei ersten Positionen stimmen alle Grundpositionen<br />
überein. Dabei konnte sich Strauss – im einen wie im anderen Falle – auf den Kopisten und Arrangeur<br />
Georg Kraus verlassen. Kraus war Kontrabassist der Strauss-Kapelle, geboren 1812, wohnhaft<br />
Altlerchenfeld 116 (siehe Jäger-Sunstenau Dok. 13).<br />
Kraus schrieb die Stimmen zu op. 314 für die Strauss-Kapelle (MHc-12199). Kraus hatte aber auch die<br />
Partituren für die Opera 251, 265, 268 besorgt, denen Strauss seine Melodien für die Walzer „An der<br />
schönen blauen Donau“ entnahm. Die Partituren der Opera 251 und 265 sind sogar von Kraus signiert.<br />
Es liegt folglich nahe, Georg Kraus auch als Einrichter der Partitur der instrumentalen Walzer-Folge<br />
op. 314 zu benennen, der im Rückgriff auf die Instrumentationen der recycelten Nummern und des bei<br />
der Uraufführung verwendeten Materials tätig geworden ist.<br />
Das zur Uraufführung bereitgestellte Material (noch ohne Introduktion und ohne Coda) konnte relativ<br />
leicht aus dem von Strauss für den Wiener MGV geschaffenen Vorlagen (Klavier-Begleitstimme Noten II<br />
Archiv MGV, Melodien in den von Weinwurm bereinigten Chorstimmen nach Noten I und Noten III Archiv<br />
MGV) geschaffen werden. Als zusammenstellende Arrangeure kommen infrage: die Militärkapellmeister<br />
Josef Wiedemann (IR 42) und Johann Proksch (einst IR 12).<br />
Es ist durchaus möglich, dass die Genannten auf die von Kraus geschriebenen Partituren zurückgegriffen<br />
oder gar mit Kraus zusammengearbeitet haben. Für die Militärkapelle des IR 42 waren freilich die zahl-<br />
43