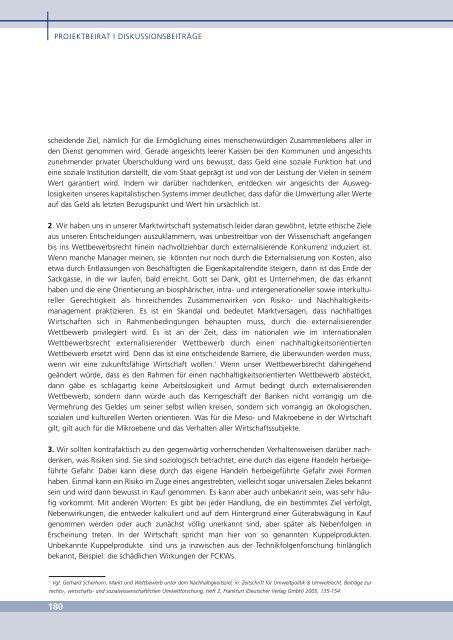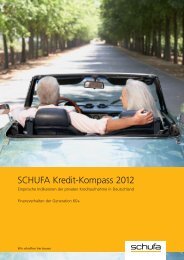C Sozialprofile ver- und überschuldeter junger Erwachsener
C Sozialprofile ver- und überschuldeter junger Erwachsener
C Sozialprofile ver- und überschuldeter junger Erwachsener
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PROJEKTBEIRAT | DISKUSSIONSBEITRÄGE<br />
scheidende Ziel, nämlich für die Ermöglichung eines menschenwürdigen Zusammenlebens aller in<br />
den Dienst genommen wird. Gerade angesichts leerer Kassen bei den Kommunen <strong>und</strong> angesichts<br />
zunehmender privater Überschuldung wird uns bewusst, dass Geld eine soziale Funktion hat <strong>und</strong><br />
eine soziale Institution darstellt, die vom Staat geprägt ist <strong>und</strong> von der Leistung der Vielen in seinem<br />
Wert garantiert wird. Indem wir darüber nachdenken, entdecken wir angesichts der Ausweglosigkeiten<br />
unseres kapitalistischen Systems immer deutlicher, dass dafür die Umwertung aller Werte<br />
auf das Geld als letzten Bezugspunkt <strong>und</strong> Wert hin ursächlich ist.<br />
2. Wir haben uns in unserer Marktwirtschaft systematisch leider daran gewöhnt, letzte ethische Ziele<br />
aus unseren Entscheidungen auszuklammern, was unbestreitbar von der Wissenschaft angefangen<br />
bis ins Wettbewerbsrecht hinein nachvollziehbar durch externalisierende Konkurrenz induziert ist.<br />
Wenn manche Manager meinen, sie könnten nur noch durch die Externalisierung von Kosten, also<br />
etwa durch Entlassungen von Beschäftigten die Eigenkapitalrendite steigern, dann ist das Ende der<br />
Sackgasse, in die wir laufen, bald erreicht. Gott sei Dank, gibt es Unternehmen, die das erkannt<br />
haben <strong>und</strong> die eine Orientierung an biosphärischer, intra- <strong>und</strong> intergenerationeller sowie interkultureller<br />
Gerechtigkeit als hinreichendes Zusammenwirken von Risiko- <strong>und</strong> Nachhaltigkeitsmanagement<br />
praktizieren. Es ist ein Skandal <strong>und</strong> bedeutet Markt<strong>ver</strong>sagen, dass nachhaltiges<br />
Wirtschaften sich in Rahmenbedingungen behaupten muss, durch die externalisierender<br />
Wettbewerb privilegiert wird. Es ist an der Zeit, dass im nationalen wie im internationalen<br />
Wettbewerbsrecht externalisierender Wettbewerb durch einen nachhaltigkeitsorientierten<br />
Wettbewerb ersetzt wird. Denn das ist eine entscheidende Barriere, die überw<strong>und</strong>en werden muss,<br />
wenn wir eine zukunftsfähige Wirtschaft wollen. 1 Wenn unser Wettbewerbsrecht dahingehend<br />
geändert würde, dass es den Rahmen für einen nachhaltigkeitsorientierten Wettbewerb absteckt,<br />
dann gäbe es schlagartig keine Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> Armut bedingt durch externalisierenden<br />
Wettbewerb, sondern dann würde auch das Kerngeschäft der Banken nicht vorrangig um die<br />
Vermehrung des Geldes um seiner selbst willen kreisen, sondern sich vorrangig an ökologischen,<br />
sozialen <strong>und</strong> kulturellen Werten orientieren. Was für die Meso- <strong>und</strong> Makroebene in der Wirtschaft<br />
gilt, gilt auch für die Mikroebene <strong>und</strong> das Verhalten aller Wirtschaftssubjekte.<br />
3. Wir sollten kontrafaktisch zu den gegenwärtig vorherrschenden Verhaltensweisen darüber nachdenken,<br />
was Risiken sind. Sie sind soziologisch betrachtet, eine durch das eigene Handeln herbeigeführte<br />
Gefahr. Dabei kann diese durch das eigene Handeln herbeigeführte Gefahr zwei Formen<br />
haben. Einmal kann ein Risiko im Zuge eines angestrebten, vielleicht sogar uni<strong>ver</strong>salen Zieles bekannt<br />
sein <strong>und</strong> wird dann bewusst in Kauf genommen. Es kann aber auch unbekannt sein, was sehr häufig<br />
vorkommt. Mit anderen Worten: Es gibt bei jeder Handlung, die ein bestimmtes Ziel <strong>ver</strong>folgt,<br />
Nebenwirkungen, die entweder kalkuliert <strong>und</strong> auf dem Hintergr<strong>und</strong> einer Güterabwägung in Kauf<br />
genommen werden oder auch zunächst völlig unerkannt sind, aber später als Nebenfolgen in<br />
Erscheinung treten. In der Wirtschaft spricht man hier von so genannten Kuppelprodukten.<br />
Unbekannte Kuppelprodukte sind uns ja inzwischen aus der Technikfolgenforschung hinlänglich<br />
bekannt, Beispiel: die schädlichen Wirkungen der FCKWs.<br />
1 Vgl. Gerhard Scherhorn, Markt <strong>und</strong> Wettbewerb unter dem Nachhaltigkeitsziel, in: Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht. Beiträge zur<br />
rechts-, wirtschafts- <strong>und</strong> sozialwissenschaftlichen Umweltforschung, Heft 2, Frankfurt (Deutscher Verlag GmbH) 2005, 135-154.<br />
180