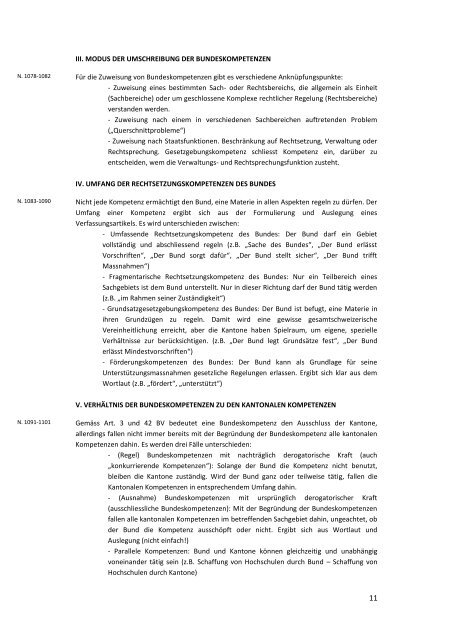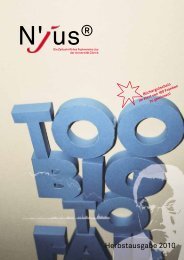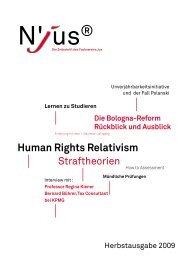Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –
Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –
Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
N. 1078-1082<br />
N. 1083-1090<br />
N. 1091-1101<br />
III. MODUS DER UMSCHREIBUNG DER BUNDESKOMPETENZEN<br />
Für die Zuweisung von Bundeskompetenzen gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte:<br />
- Zuweisung eines bestimmten Sach- oder Rechtsbereichs, die allgemein als Einheit<br />
(Sachbereiche) oder um geschlossene Komplexe rechtlicher Regelung (Rechtsbereiche)<br />
verstanden werden.<br />
- Zuweisung nach einem in verschiedenen Sachbereichen auftretenden Problem<br />
(„Querschnittprobleme“)<br />
- Zuweisung nach Staatsfunktionen. Beschränkung auf Rechtsetzung, Verwaltung oder<br />
Rechtsprechung. Gesetzgebungskompetenz schliesst Kompetenz ein, darüber zu<br />
entscheiden, wem die Verwaltungs- und Rechtsprechungsfunktion zusteht.<br />
IV. UMFANG DER RECHTSETZUNGSKOMPETENZEN DES BUNDES<br />
Nicht jede Kompetenz ermächtigt den Bund, eine Materie in allen Aspekten regeln zu dürfen. Der<br />
Umfang einer Kompetenz ergibt sich aus der Formulierung und Auslegung eines<br />
Verfassungsartikels. Es wird unterschieden zwischen:<br />
- Umfassende Rechtsetzungskompetenz des Bundes: Der Bund darf ein Gebiet<br />
vollständig und abschliessend regeln (z.B. „Sache des Bundes“, „Der Bund erlässt<br />
Vorschriften“, „Der Bund sorgt dafür“, „Der Bund stellt sicher“, „Der Bund trifft<br />
Massnahmen“)<br />
- Fragmentarische Rechtsetzungskompetenz des Bundes: Nur ein Teilbereich eines<br />
Sachgebiets ist dem Bund unterstellt. Nur in dieser Richtung darf der Bund tätig werden<br />
(z.B. „im Rahmen seiner Zuständigkeit“)<br />
- Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes: Der Bund ist befugt, eine Materie in<br />
ihren Grundzügen zu regeln. Damit wird eine gewisse gesamtschweizerische<br />
Vereinheitlichung erreicht, aber die Kantone haben Spielraum, um eigene, spezielle<br />
Verhältnisse zur berücksichtigen. (z.B. „Der Bund legt Grundsätze fest“, „Der Bund<br />
erlässt Mindestvorschriften“)<br />
- Förderungskompetenzen des Bundes: Der Bund kann als Grundlage für seine<br />
Unterstützungsmassnahmen gesetzliche Regelungen erlassen. Ergibt sich klar aus dem<br />
Wortlaut (z.B. „fördert“, „unterstützt“)<br />
V. VERHÄLTNIS DER BUNDESKOMPETENZEN ZU DEN KANTONALEN KOMPETENZEN<br />
Gemäss Art. 3 und 42 BV bedeutet eine Bundeskompetenz den Ausschluss der Kantone,<br />
allerdings fallen nicht immer bereits mit der Begründung der Bundeskompetenz alle kantonalen<br />
Kompetenzen dahin. Es werden drei Fälle unterschieden:<br />
- (Regel) Bundeskompetenzen mit nachträglich derogatorische Kraft (auch<br />
„konkurrierende Kompetenzen“): Solange der Bund die Kompetenz nicht benutzt,<br />
bleiben die Kantone zuständig. Wird der Bund ganz oder teilweise tätig, fallen die<br />
Kantonalen Kompetenzen in entsprechendem Umfang dahin.<br />
- (Ausnahme) Bundeskompetenzen mit ursprünglich derogatorischer Kraft<br />
(ausschliessliche Bundeskompetenzen): Mit der Begründung der Bundeskompetenzen<br />
fallen alle kantonalen Kompetenzen im betreffenden Sachgebiet dahin, ungeachtet, ob<br />
der Bund die Kompetenz ausschöpft oder nicht. Ergibt sich aus Wortlaut und<br />
Auslegung (nicht einfach!)<br />
- Parallele Kompetenzen: Bund und Kantone können gleichzeitig und unabhängig<br />
voneinander tätig sein (z.B. Schaffung von Hochschulen durch Bund <strong>–</strong> Schaffung von<br />
Hochschulen durch Kantone)<br />
11