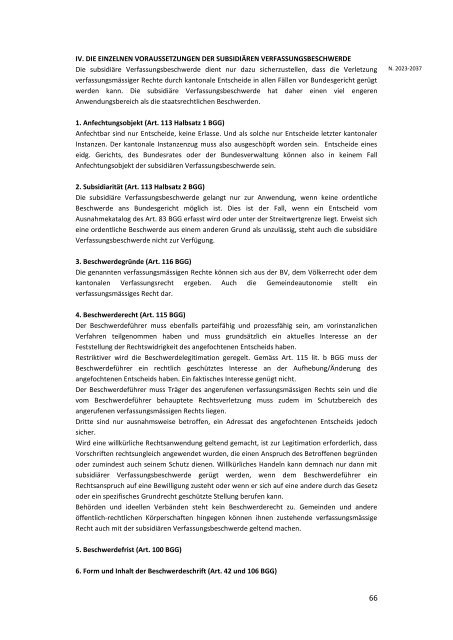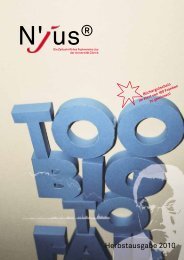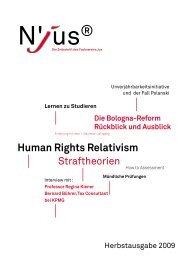Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –
Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –
Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
IV. DIE EINZELNEN VORAUSSETZUNGEN DER SUBSIDIÄREN VERFASSUNGSBESCHWERDE<br />
Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde dient nur dazu sicherzustellen, dass die Verletzung<br />
verfassungsmässiger Rechte durch kantonale Entscheide in allen Fällen vor Bundesgericht gerügt<br />
werden kann. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde hat daher einen viel engeren<br />
Anwendungsbereich als die staatsrechtlichen Beschwerden.<br />
1. Anfechtungsobjekt (Art. 113 Halbsatz 1 BGG)<br />
Anfechtbar sind nur Entscheide, keine Erlasse. Und als solche nur Entscheide letzter kantonaler<br />
Instanzen. Der kantonale Instanzenzug muss also ausgeschöpft worden sein. Entscheide eines<br />
eidg. Gerichts, des Bundesrates oder der Bundesverwaltung können also in keinem Fall<br />
Anfechtungsobjekt der subsidiären Verfassungsbeschwerde sein.<br />
2. Subsidiarität (Art. 113 Halbsatz 2 BGG)<br />
Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gelangt nur zur Anwendung, wenn keine ordentliche<br />
Beschwerde ans Bundesgericht möglich ist. Dies ist der Fall, wenn ein Entscheid vom<br />
Ausnahmekatalog des Art. 83 BGG erfasst wird oder unter der Streitwertgrenze liegt. Erweist sich<br />
eine ordentliche Beschwerde aus einem anderen Grund als unzulässig, steht auch die subsidiäre<br />
Verfassungsbeschwerde nicht zur Verfügung.<br />
3. Beschwerdegründe (Art. 116 BGG)<br />
Die genannten verfassungsmässigen Rechte können sich aus der BV, dem Völkerrecht oder dem<br />
kantonalen Verfassungsrecht ergeben. Auch die Gemeindeautonomie stellt ein<br />
verfassungsmässiges Recht dar.<br />
4. Beschwerderecht (Art. 115 BGG)<br />
Der Beschwerdeführer muss ebenfalls parteifähig und prozessfähig sein, am vorinstanzlichen<br />
Verfahren teilgenommen haben und muss grundsätzlich ein aktuelles Interesse an der<br />
Feststellung der Rechtswidrigkeit des angefochtenen Entscheids haben.<br />
Restriktiver wird die Beschwerdelegitimation geregelt. Gemäss Art. 115 lit. b BGG muss der<br />
Beschwerdeführer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung/Änderung des<br />
angefochtenen Entscheids haben. Ein faktisches Interesse genügt nicht.<br />
Der Beschwerdeführer muss Träger des angerufenen verfassungsmässigen Rechts sein und die<br />
vom Beschwerdeführer behauptete Rechtsverletzung muss zudem im Schutzbereich des<br />
angerufenen verfassungsmässigen Rechts liegen.<br />
Dritte sind nur ausnahmsweise betroffen, ein Adressat des angefochtenen Entscheids jedoch<br />
sicher.<br />
Wird eine willkürliche Rechtsanwendung geltend gemacht, ist zur Legitimation erforderlich, dass<br />
Vorschriften rechtsungleich angewendet wurden, die einen Anspruch des Betroffenen begründen<br />
oder zumindest auch seinem Schutz dienen. Willkürliches Handeln kann demnach nur dann mit<br />
subsidiärer Verfassungsbeschwerde gerügt werden, wenn dem Beschwerdeführer ein<br />
Rechtsanspruch auf eine Bewilligung zusteht oder wenn er sich auf eine andere durch das Gesetz<br />
oder ein spezifisches Grundrecht geschützte Stellung berufen kann.<br />
Behörden und ideellen Verbänden steht kein Beschwerderecht zu. Gemeinden und andere<br />
öffentlich-rechtlichen Körperschaften hingegen können ihnen zustehende verfassungsmässige<br />
Recht auch mit der subsidiären Verfassungsbeschwerde geltend machen.<br />
5. Beschwerdefrist (Art. 100 BGG)<br />
6. Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Art. 42 und 106 BGG)<br />
66<br />
N. 2023-2037