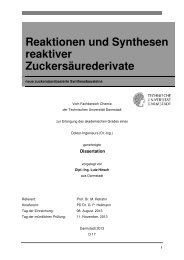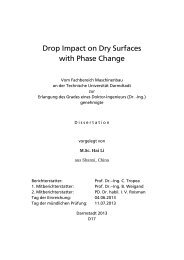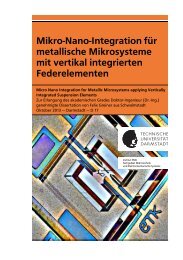Download (11Mb) - tuprints
Download (11Mb) - tuprints
Download (11Mb) - tuprints
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. Medizinische Aspekte<br />
In Abbildung 5.6 ist dies für den Fall eines verkürzten Erregungsimpulses skizziert:<br />
Die dreieckige Struktur stellt dabei einen vereinfachten und stark vergröÿerten Ausschnitt<br />
aus dem Reizleitungssystem einer Herzkammer (Purkinje-Fasern) dar, in dem<br />
die einzelnen Leitungen durch ihre gegenseitige Vermaschung eine ringförmige Leiterstruktur<br />
bilden.<br />
In der linken Spalte von Abbildung 5.6 ist dabei der Normalzustand dargestellt:<br />
Die Reizwelle läuft in die Dreiecksstruktur und teilt sich auf beide Schenkel auf. Dabei<br />
werden die Zellen dort polarisiert und dadurch absolut refraktär (durch schwarze<br />
Färbung symbolisiert). Im unteren Schenkel treen die beiden Teilwellen wieder aufeinander.<br />
Da in diesem Moment beide Seiten noch absolut refraktär sind, können<br />
sich die beiden Teilwellen zur Mitte hin nicht weiter ausbreiten, wodurch sich die<br />
Erregung in die benachbarten Strukturen des Reizleitungssystems fortsetzt.<br />
In der mittleren Spalte ist der Fall einer stark verkürzten Reizwelle dargestellt.<br />
Auch diese Welle teilt sich auf die beiden Schenkel auf und vereinigt sich im unteren<br />
Schenkel wieder. Die Zone der relativen Refraktivität (gestrichelt dargestellt) folgt<br />
dabei unmittelbar. Da die beiden Seiten jedoch ungefähr gleich stark refraktär sind,<br />
breitet sich auch hier die Reizwelle in die benachbarten Strukturen aus.<br />
In der rechten Spalte schlieÿlich ist einer der beiden Schenkel der Dreiecksstruktur<br />
beim Einlaufen der Reizwelle noch absolut refraktär, beispielsweise durch eine<br />
vorherigen Reiz. Die einlaufende Reizwelle kann daher nur den Weg über den anderen<br />
Schenkel nehmen. Ist diese jedoch im unteren Schenkel angekommen, ist der<br />
ursprünglich blockierte Schenkel nicht mehr refraktär und die Reizwelle kann in ihm<br />
zurücklaufen, sodass sich ein Kreislauf ergeben kann. Tritt dieser Fall ein, wird die<br />
Herzkammermuskulatur durch die schnell im Kreis laufende Reizwelle nur noch unvollständig<br />
erregt, zuckt nurmehr unkontrolliert und kann kein Blut mehr pumpen.<br />
Man spricht hierbei von Herzkammerimmern 1 (ventrikuläre Fibrillation). Dieser<br />
Zustand ist unmittelbar lebensbedrohlich, da durch die fehlende Pumpleistung des<br />
Herzens der Blutkreislauf zusammenbricht. Zudem kann sich das Herz im Gegensatz<br />
zu einem Herzstillstand, vgl. vorheriges Kapitel nicht selbstständig aus diesem<br />
Zustand befreien. Nur eine sogenannte Debrillation durch einen gezielt von auÿen<br />
angewendeten Stromstoÿ löst sozusagen einen Reset des Herzens aus, sodass der<br />
Sinusknoten wieder die Steuerung der Herzfunktion übernehmen kann. Bis zur De-<br />
brillation muss die Zeit mit Herz-Lungen-Wiederbelebung überbrückt werden, um<br />
insbesondere die Sauerstozufuhr zum Gehirn aufrecht zu erhalten.<br />
Herzkammerimmern kann jedoch auch durch externe Einüsse ausgelöst werden,<br />
wie Abbildung 5.7 zeigt.<br />
Während der T-Welle des EKG bildet sich die Erregung der Herzkammern zurück<br />
(vgl. vorheriger Abschnitt), und die Zellen des Reizleitungssystems benden sich in<br />
einem relativ refraktären Zustand. Trit genau während dieser Zeit ein externer elektrischer<br />
Reiz auf das Herz, kann es ebenfalls zu einem Wiedereintritt der dadurch<br />
ausgelösten Erregungswelle im Reizleitungssystem kommen, was ebenso zu Kammer-<br />
1<br />
Der Name leitet sich davon ab, dass bei einem oenliegenden Herz die Muskelzuckungen wie ein<br />
Flimmern der Oberäche des Herzens wahrnehmbar sind.<br />
34