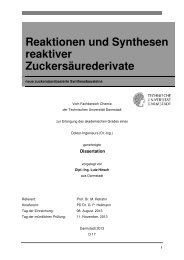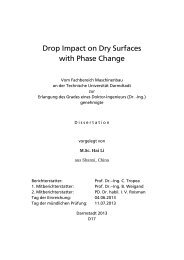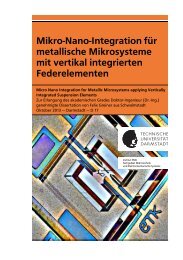Download (11Mb) - tuprints
Download (11Mb) - tuprints
Download (11Mb) - tuprints
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6.2. Voruntersuchungen<br />
6.2.2. Einuss von Kellerwänden und Betonarmierungen auf<br />
Schrittspannungen<br />
Einuss von Armierung in der Fundamentplatte<br />
Wie in Kapitel 7.1.1 beschrieben, wurden bei allen in dieser Arbeit gezeigten Simulationen<br />
die Fundamentplatte eines Gebäudes stets als reine Betonplatte ohne Armierung<br />
modelliert oder sogar ganz weggelassen (siehe z. B. Tiefen- und Schrägerder). In<br />
der Praxis ist jedoch davon auszugehen, dass eine Fundamentplatte mit Stahlbewehrung<br />
versehen ist, welche sofern die Bodenplatte gegenüber dem Erdboden nicht<br />
elektrisch isoliert ist, vgl. Kapitel 6.1.2 einen Einuss auf die Stromverteilung und<br />
damit auf die entstehenden Schrittspannungen haben könnte.<br />
Zwecks vereinfachter Modellierung und Reduzierung des Rechenzeitbedarfs wurde<br />
dabei die Armierung nicht mit diskreten Stäben realer Baustahlmatten nachgebildet,<br />
sondern als massiver Stahlkörper, der wie der Fundamenterder und die angenommene<br />
Armierung eine Betonüberdeckung von 5 cm aufweist. Diese Vereinfachung<br />
entstand aus der Überlegung heraus, dass der Stahl der Armierung eine Leitfähigkeit<br />
besitzt, die um mehrere Gröÿenordnungen über der von Beton liegt. Somit ist davon<br />
auszugehen, dass sich der Strom im Wesentlichen auf die Armierung konzentriert und<br />
lediglich auf der 5-cm-Strecke zwischen Bewehrung und Erdboden durch den Beton<br />
ieÿt. Dass diese Annahme mit akzeptabler Genauigkeit zutreend ist, haben auch<br />
Voruntersuchungen per Simulation bestätigt, die jedoch aus Platzgründen hier nicht<br />
dargestellt sind.<br />
Als Ausgangsmodell für diese Untersuchung diente ein Gebäude von 10 m × 10 m.<br />
Es wurden dabei zwei mögliche Fälle bezüglich der Kontaktierung der Armierung<br />
modelliert:<br />
• Eine Armierung, die nicht elektrisch mit dem Fundamenterder verbunden ist.<br />
Dazu hat der Bewehrungskörper allseitig einen Abstand von 5 cm vom Fundamenterder<br />
sowie einen Abstand von 5 cm zur Unterkante der Fundamentplatte<br />
(vgl. Abbildung 6.11a).<br />
• Eine Armierung, die elektrisch mit dem Fundamenterder kontaktiert ist. Dabei<br />
wurde der Fundamenterder weggelassen und stattdessen der Bewehrungskörper<br />
seitlich ausgedehnt, sodass er auch 5 cm Abstand vom Rand der Fundamentplatte<br />
hat (vgl. Abbildung 6.11b).<br />
Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.12 zu sehen. Dabei ist zum Vergleich auch<br />
der Schrittspannungsverlauf eines Fundamenterders ohne jegliche Armierung eingezeichnet.<br />
Die Ergebnisse sowohl der nicht kontaktierten (FE + isol. Armierung in<br />
Abbildung 6.12) als auch der elektrisch kontaktierten Armierung (Armierung in Abbildung<br />
6.12) liegen dabei niedriger als bei Berücksichtigung eines Fundamenterders<br />
alleine. Auÿerdem fällt auf, dass sich die Ergebnisse der beiden Bewehrungsvarianten<br />
nur minimal unterscheiden.<br />
Im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung wurden für die Simulationen der übrigen<br />
Fundamenterder und Fundamenterder-Ringerder-Kombinationen (Kapitel 7.1.1 und<br />
75