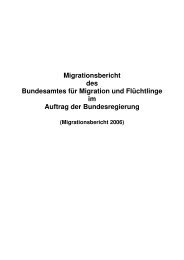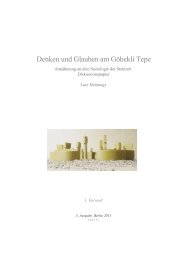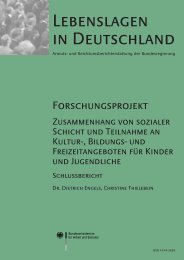Download - Gesis
Download - Gesis
Download - Gesis
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
man arbeiten und wie nicht? Welche Erkenntnisse<br />
haben Priorität? u. s. w. Der epistemische<br />
Lebensraum hat aber auch eine räumliche Dimension:<br />
Es geht um die materielle Umgebung<br />
und die durch sie bestimmten Möglichkeiten<br />
und Beschränkungen (z. B. Zugang zu Ressourcen),<br />
aber auch um die implizite Geographie, in<br />
der man sich verortet. Diese Geographie erlaubt<br />
sowohl eine Verortung der Forschungsfrage im<br />
Zentrum oder an der Peripherie des Feldes als<br />
auch des institutionellen Rahmens (arbeite ich<br />
an einer renommierten Institution oder befindet<br />
sich mein Arbeitsplatz eher an der Peripherie).<br />
All dies sind wesentliche Aspekte, die mehr<br />
oder weniger Freiraum schaffen. Aber epistemische<br />
Lebensräume haben auch eine zeitliche<br />
Struktur: Es geht um Tempo, Lebensrhythmus,<br />
Produktionszyklen, Zeithorizonte und vieles<br />
mehr. Sie sind sozial strukturiert, ermöglichen<br />
und fördern also bestimmte Formen des Zusammenseins<br />
und der Kooperation, während sie andere<br />
erschweren, und machen so fest, welchen<br />
Platz individuelle Entscheidungen gegenüber<br />
kollektiven Ausrichtungen haben. Schließlich<br />
gibt es eine Fülle von symbolischen Ordnungen<br />
und Leitwerten, wie Exzellenz, Audit, Mobilität,<br />
Rankings, die diesen Lebensraum mehr oder<br />
weniger wohnlich gestalten.<br />
Spurensuche: Über die vielfältigen und<br />
unsichtbaren Geschlechterordnungen in der<br />
Wissenschaft<br />
im Wissenschaftsbetrieb Geschlechterordnungen<br />
hergestellt werden bzw. zum Tragen kommen.<br />
Es geht also darum, die bisweilen unsichtbaren,<br />
in die sozialen, kognitiven und institutionellen<br />
Strukturen der Wissenschaft eingewobenen<br />
Geschlechterordnungen herauszuarbeiten. Es<br />
gilt aufzuzeigen, dass „leiser Ausschluss“ durch<br />
eine Vielzahl von scheinbar „neutralen“ Praktiken<br />
vollzogen wird, dass durch sie bestimmte<br />
Geschlechterordnungen immer wieder performiert<br />
werden. Geschlecht wird, wie bereits eingangs<br />
erwähnt, in diesem Sinne nicht als eine<br />
fixe Kategorie angesehen, sondern wird erst in<br />
einem kontinuierlichen Prozess der Rekonfiguration<br />
immer wieder aufs Neue hergestellt.<br />
Der Frage der Geschlechterbeziehungen in der<br />
Wissenschaft nachzugehen, bedeutet dann, den<br />
Assemblagen von Momenten, an denen Geschlechterordnungen<br />
performiert werden, mehr<br />
Aufmerksamkeit zu schenken. Eine Sensibilisierung<br />
für den „leisen Ausschluss“ scheint<br />
auch deshalb wichtig, weil viele ForscherInnen,<br />
auch wenn sie selbst davon betroffen sind,<br />
diese Ausschlüsse nicht benennen und oft sogar<br />
negieren.<br />
Ich möchte nun beispielhaft drei Kontexte<br />
skizzieren, in denen bei genauerer Betrachtung<br />
Ordnungen und deren potenziell ausschließende<br />
Wirkung für Frauen sichtbar werden.<br />
Audit-Strukturen<br />
VORTRÄGE<br />
Ausgehend von diesen konzeptuellen Überlegungen<br />
möchte ich mich kurz auf eine Art von<br />
Spurensuche machen und überlegen, wie an<br />
sehr unterschiedlichen Stellen und Momenten<br />
Der erste Kontext verweist auf die verstärkte<br />
Implementierung von sogenannten Audit-<br />
Strukturen auf unterschiedlichen Ebenen des<br />
Wissenschaftssystems, als Teil einer größeren<br />
69