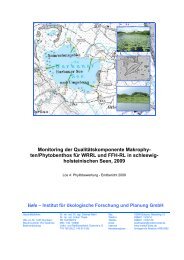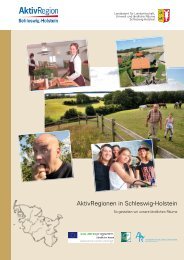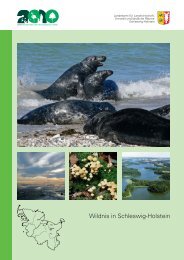Die Böden Schleswig-Holsteins - Landesamt für Landwirtschaft ...
Die Böden Schleswig-Holsteins - Landesamt für Landwirtschaft ...
Die Böden Schleswig-Holsteins - Landesamt für Landwirtschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
60<br />
<strong>Die</strong> Karte in Abbildung 5 zeigt in groben Zügen<br />
das Verteilungsmuster der Bodentypen bzw.<br />
der Bodengesellschaften in <strong>Schleswig</strong>-Holstein.<br />
Dabei fällt beim Vergleich mit der Karte<br />
der Hauptnaturräume die gute Übereinstimmung<br />
wesentlicher Grenzen auf.<br />
Von West nach Ost lassen sich folgende<br />
Grundzüge erkennen: <strong>Die</strong> Marschen gliedern<br />
sich in die jüngeren Köge mit Kalk- und Kleimarschen<br />
und die älteren Köge mit Dwogund<br />
Knickmarschen. <strong>Die</strong> Hohe Geest oder das<br />
Altmoränengebiet wird von Braunerden und<br />
deren Übergängen zum Podsol und stellenweise<br />
von Pseudogleyen dominiert. Das Gebiet<br />
der Vorgeest hingegen wird überwiegend<br />
von Gleyen und Podsolen sowie Niedermooren<br />
eingenommen. Schließlich dominieren im<br />
Östlichen Hügelland (Jungmoränengebiet) Parabraunerden<br />
und deren Übergänge zum<br />
Pseudogley. Niedermoore und Hochmoore finden<br />
sich besonders im Übergang von der<br />
Marsch zur Geest, sind aber in allen Hauptnaturräumen<br />
stellenweise vertreten. Bei der Darstellung<br />
ist zu beachten, dass lediglich die flächenmäßig<br />
dominanten Bodentypen benannt<br />
wurden und die Struktur der Bodendecke in<br />
der Natur wesentlich vielfältiger und kleinteiliger<br />
ist.<br />
Zur Verdeutlichung der zeitlichen Einordnung,<br />
Entstehung und Vorkommen der Bodenausgangsgesteine<br />
soll Tabelle 4 beitragen, auf die<br />
in den folgenden Unterkapiteln eingegangen<br />
wird.<br />
4.1 Marsch, Watt und Elbtal<br />
4.1.1 Lage, geologische Entstehung und<br />
Oberflächenformung<br />
Der <strong>Schleswig</strong>-Holsteinische Hauptnaturraum<br />
der Marsch liegt im Westen des Landes an<br />
der Nordseeküste, er zieht sich jedoch zum<br />
Beispiel entlang der Eider weit ins Landesinnere<br />
hinein und reicht im Elbeästuar bis zum<br />
Hamburger Stromteilungsgebiet. <strong>Die</strong> Elbniederung<br />
östlich von Geesthacht zählt wegen des<br />
fehlenden Tideeinflusses nicht mehr zur<br />
Marsch, sondern wird als eigener Naturraum<br />
aufgefasst. Das Watt und die Nordseeinseln<br />
werden dagegen dem Küstenholozän (Landschaft<br />
nacheiszeitlicher Küstenablagerungen)<br />
zugeordnet.<br />
<strong>Die</strong> geologische Entstehung dieser Naturräume<br />
ist im Wesentlichen auf nacheiszeitliche<br />
Prozesse wie den Anstieg des Meeresspiegels<br />
und die Sedimentation von Gezeiten-,<br />
Fluss- und organischen Sedimenten (Torfen<br />
und Mudden) zurückzuführen.<br />
Für den Bereich des Küstenholozäns können<br />
bezüglich der geologischen Entwicklung in der<br />
Nacheiszeit im Wesentlichen drei Gebiete unterschieden<br />
werden: <strong>Die</strong>s sind einerseits die<br />
Nordfriesischen Inseln zusammen mit den<br />
Halligen und Wattgebieten, andererseits die<br />
Nordfriesische Marsch mit dem nördlichen Eiderstedt<br />
und schließlich die Marsch südlich<br />
des Eiderstedter Strandwallsystems bis zum<br />
Hamburger Stromteilungsgebiet. Während die<br />
Nordfriesische Marsch im Verlauf der Nacheiszeit<br />
durch einen starken Wechsel von Sedimentation<br />
von Meeresablagerungen und Abtrag<br />
derselben sowie des Angriffs auf die eiszeitlichen<br />
Geestdurchragungen geprägt wurde,<br />
wirkten sich die Meerestransgressionen<br />
(Meeresspiegelanstiege) in Dithmarschen und<br />
im Elbeästuar weitaus weniger dramatisch<br />
aus. Hier kann von einer rhythmischen Zunahme<br />
der Mächtigkeit der Meeressedimente<br />
ausgegangen werden.<br />
Im Einzelnen lassen sich in Abhängigkeit von<br />
der nacheiszeitlichen Meeresspiegelentwicklung<br />
folgende Sedimente und Bodenbildungshorizonte<br />
(Dwöge) den Trans- und Regressionsphasen<br />
zuordnen (Tabelle 5):