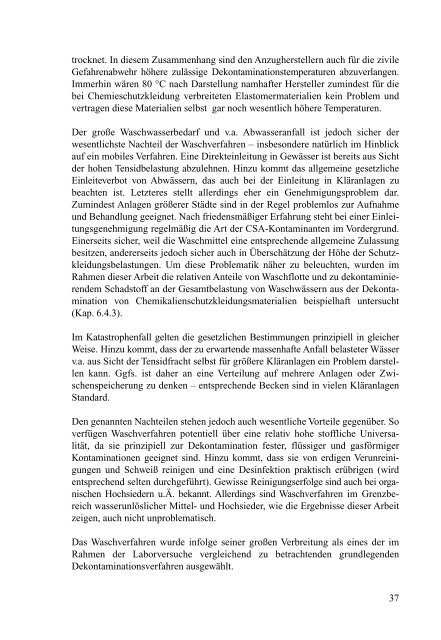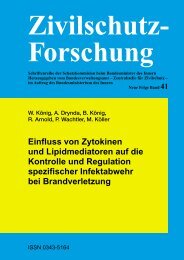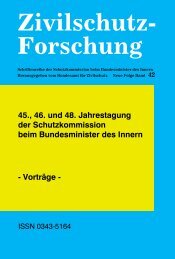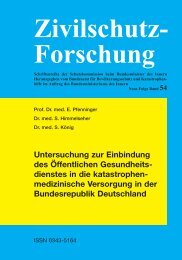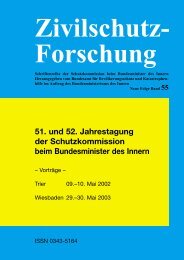Zivilschutz- Forschung - Schutzkommission
Zivilschutz- Forschung - Schutzkommission
Zivilschutz- Forschung - Schutzkommission
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
trocknet. In diesem Zusammenhang sind den Anzugherstellern auch für die zivile<br />
Gefahrenabwehr höhere zulässige Dekontaminationstemperaturen abzuverlangen.<br />
Immerhin wären 80 °C nach Darstellung namhafter Hersteller zumindest für die<br />
bei Chemieschutzkleidung verbreiteten Elastomermaterialien kein Problem und<br />
vertragen diese Materialien selbst gar noch wesentlich höhere Temperaturen.<br />
Der große Waschwasserbedarf und v.a. Abwasseranfall ist jedoch sicher der<br />
wesentlichste Nachteil der Waschverfahren – insbesondere natürlich im Hinblick<br />
auf ein mobiles Verfahren. Eine Direkteinleitung in Gewässer ist bereits aus Sicht<br />
der hohen Tensidbelastung abzulehnen. Hinzu kommt das allgemeine gesetzliche<br />
Einleiteverbot von Abwässern, das auch bei der Einleitung in Kläranlagen zu<br />
beachten ist. Letzteres stellt allerdings eher ein Genehmigungsproblem dar.<br />
Zumindest Anlagen größerer Städte sind in der Regel problemlos zur Aufnahme<br />
und Behandlung geeignet. Nach friedensmäßiger Erfahrung steht bei einer Einleitungsgenehmigung<br />
regelmäßig die Art der CSA-Kontaminanten im Vordergrund.<br />
Einerseits sicher, weil die Waschmittel eine entsprechende allgemeine Zulassung<br />
besitzen, andererseits jedoch sicher auch in Überschätzung der Höhe der Schutzkleidungsbelastungen.<br />
Um diese Problematik näher zu beleuchten, wurden im<br />
Rahmen dieser Arbeit die relativen Anteile von Waschflotte und zu dekontaminierendem<br />
Schadstoff an der Gesamtbelastung von Waschwässern aus der Dekontamination<br />
von Chemikalienschutzkleidungsmaterialien beispielhaft untersucht<br />
(Kap. 6.4.3).<br />
Im Katastrophenfall gelten die gesetzlichen Bestimmungen prinzipiell in gleicher<br />
Weise. Hinzu kommt, dass der zu erwartende massenhafte Anfall belasteter Wässer<br />
v.a. aus Sicht der Tensidfracht selbst für größere Kläranlagen ein Problem darstellen<br />
kann. Ggfs. ist daher an eine Verteilung auf mehrere Anlagen oder Zwischenspeicherung<br />
zu denken – entsprechende Becken sind in vielen Kläranlagen<br />
Standard.<br />
Den genannten Nachteilen stehen jedoch auch wesentliche Vorteile gegenüber. So<br />
verfügen Waschverfahren potentiell über eine relativ hohe stoffliche Universalität,<br />
da sie prinzipiell zur Dekontamination fester, flüssiger und gasförmiger<br />
Kontaminationen geeignet sind. Hinzu kommt, dass sie von erdigen Verunreinigungen<br />
und Schweiß reinigen und eine Desinfektion praktisch erübrigen (wird<br />
entsprechend selten durchgeführt). Gewisse Reinigungserfolge sind auch bei organischen<br />
Hochsiedern u.Ä. bekannt. Allerdings sind Waschverfahren im Grenzbereich<br />
wasserunlöslicher Mittel- und Hochsieder, wie die Ergebnisse dieser Arbeit<br />
zeigen, auch nicht unproblematisch.<br />
Das Waschverfahren wurde infolge seiner großen Verbreitung als eines der im<br />
Rahmen der Laborversuche vergleichend zu betrachtenden grundlegenden<br />
Dekontaminationsverfahren ausgewählt.<br />
37