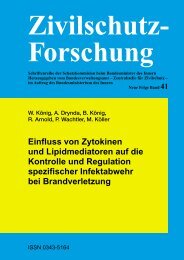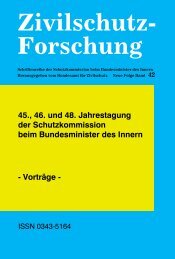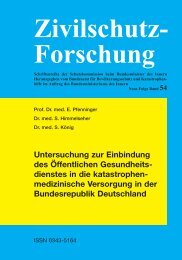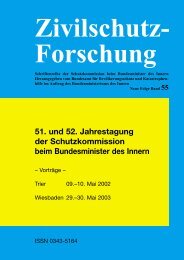Zivilschutz- Forschung - Schutzkommission
Zivilschutz- Forschung - Schutzkommission
Zivilschutz- Forschung - Schutzkommission
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Kontaminationen mit steigender Verweildauer im CSA-Material zunehmend<br />
schlechter dekontaminierbar sind, spricht im Übrigen für die Notwendigkeit einer<br />
zügigen Dekontamination nach dem Einsatz.<br />
Zur Vermeidung von Permeationsbeeinflussungen durch unterschiedliche Feuchtegehalte<br />
der CSA-Materialproben wurden im Rahmen der Versuche ausschließlich<br />
Proben eingestellter definierter Feuchte zur Kontamination eingesetzt. Die<br />
Feuchteeinstellung erfolgte nach weitgehender Ausheizung der Proben durch<br />
mehrtägige Lagerung im Klimaschrank bei 65 % relativer Feuchte und 20 °C.<br />
In den Vorversuchen kamen dabei quadratische Proben von 5 x 5 cm Kantenlänge<br />
zur Beladung und Dekontamination zum Einsatz (anfänglich vergleichend zum<br />
Ausschluß von Randeffekten auch 10 x 10 cm Proben). Zur Vereinfachung der<br />
Probenherstellung und besseren Reproduzierbarkeit der Probengröße sowie in<br />
Anpassung an die eingesetzten Fritten zur Gasphasenbeladung erfolgten die<br />
Untersuchungen später nur noch mit Rundproben von 50 mm Durchmesser, die<br />
mit einem Locheisen ausgeschlagen wurden.<br />
6.2.4 Probenbeaufschlagung<br />
Die Probenbeaufschlagung erfolgte nach unterschiedlichsten Verfahren. Ziel war<br />
die Erzielung realitätsnaher Belastungen bei guter Reproduzierbarkeit. In den<br />
Vorversuchen erfolgte die Probenkontamination durch 2-minütiges Tauchen in<br />
auf 20 °C temperiertes Xylol. Die Proben wurden zur Nachwirkung ergänzend<br />
auf 15 Minuten an der Luft liegen gelassen, ggf. abgetupft und dann sofort in die<br />
vorgeheizten Dekontaminationseinheiten überführt. Zur Aufnahme von Dekontaminationsverläufen<br />
wurden stets 8 Proben parallel kontaminiert und dekontaminiert<br />
(Waschverfahren nur 4).<br />
Die erzielten Ausgangsbelastungen waren extrem. In den Hauptversuchen erfolgten<br />
daher schwerpunktmäßig Gasphasenbeladungen. Dazu wurden die ausgestanzten<br />
Materialproben von 50 mm Durchmesser in Schraubfilter mit Glasfrittenböden<br />
der Porosität 1 (grob) und Viton-Dichtungen eingespannt und zur<br />
Beladung über die auf 20 °C bzw. 50 °C eingestellten Flüssigkeitslachen (in<br />
Petrischalen auf einem Sandbad) gestülpt. Je nach Beladungsverfahren waren die<br />
Einwirkzeit und die weitere Verfahrensweise unterschiedlich (vgl. Legende zu<br />
Tabelle 2).<br />
Bei den Gasphasenbeladungen G20 und G50 erfolgte über die gesamte 2-stündige<br />
Einwirkzeit ausschließlich eine Gasphasenbeladung über die Außenschicht<br />
(bei 20 bzw. 50 °C Flüssigkeitstemperatur und entsprechendem Partialdampfdruck<br />
bzw. Konzentration im Gasraum).<br />
51